Reviewed Publication:
Adamsky Dmitry Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy Stanford, Cal. Stanford University Press 2019 1 376
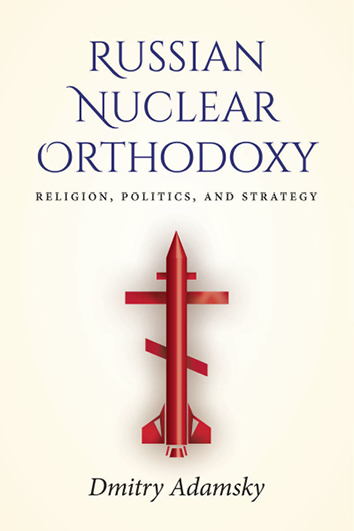
Um ein russisch-orthodox geprägtes Land bleiben zu können, muss Russland eine starke Atommacht bleiben, und um eine starke Atommacht bleiben zu können, muss Russland ein russisch-orthodox geprägtes Land bleiben – das ist, so der am Interdisciplinary Center Herzliya (Israel) lehrende Politikwissenschaftler Dmitry Adamsky, die Essenz einer weitverbreiteten und einflussreichen Doktrin im Russland der post-sowjetischen Ära. Sogar Präsident Wladimir Putin bestätigte sie explizit bei einer Pressekonferenz im Februar 2007. Adamsky nennt diese Doktrin „nukleare Orthodoxie“. Die erstmalige Wortverwendung hat Adamsky in einem im Jahr 1998 unter Pseudonym („Maksim Kalashnikov“) veröffentlichen Buch des russischen Publizisten Vladimir Kucherenko unter dem Titel Gebrochenes Schwert des Imperiums feststellen können.
Nun ist die Verbindung zwischen organisierter Religion und Militär, dem harten Kern staatlicher Sicherheitsvorsorge, weder eine neue Sache, noch eine spezifisch russische. Ohne an die vielen Beispiele für diese Verbindung in der Historie zu denken, so legen schon die aktuellen Beispiele Iran oder Saudi-Arabien nahe, dass viel darüber zu sagen wäre, wie dieses Phänomen an anderen Orten der Welt unter dort geltenden Normen und Codes ausgeprägt war und ist. In seinem wohlrecherchierten, gut strukturierten und analytisch wertvollen Buch, das auch zum Nachdenken über die nahe Zukunft anregt, überzeugt Adamsky bereits mit seiner Ausgangsannahme: Die eigenartige und kraftvolle Symbiose, welche der militärisch-industrielle Kernwaffenkomplex Russlands mit der russisch-orthodoxen Kirche seit dem Niedergang der Sowjetunion bis heute eingegangen ist, ist aufgrund ihrer sicherheitspolitischen Bedeutung so wichtig, dass sie in einer Monographie systematisch untersucht werden muss.
Adamsky teilt den Untersuchungszeitraum in drei Phasen ein – Ursprung (1990–2000), Konversion (2000–2010) und Operationalisierung (2010–2020). Die dicht recherchierte Grundlage für die Untersuchung bilden Artikel aus der russischen Presse, Verlautbarungen und Buchpublikationen der russisch-orthodoxen Kirche, der russischen Regierung und Streitkräfte sowie von Bildungsinstitutionen, die zum Dunstkreis des russischen Kernwaffenkomplexes gehören. Hinzu kommen zeitgenössische Publikationen von russischen Kommentatoren und Beobachtern des Zeitgeschehens. Für jede Phase hat der Autor seine Darstellung in drei Sektionen gegliedert und untersucht das Verhältnis zwischen dem russischen Staat und der russisch-orthodoxen Kirche, das Verhältnis zwischen dem Kernwaffenkomplex und der russisch-orthodoxen Kirche und die Entwicklung öffentlich lancierter und kursierender Narrative und Mythen in Bezug auf die beiden vorgenannten Ebenen. Adamsky organisiert den empirischen Stoff dementsprechend. Dies kommt der Les- und Vergleichbarkeit des Buches zugute.
Wie erst vergleichsweise spät diskutiert wird, ist die Geschichte, die Adamsky erzählt, in den allgemeinen Trend einer gewaltigen Bedeutungssteigerung der russisch-orthodoxen Kirche im öffentlichen und privaten Leben im post-sowjetischen Russland eingebettet, die hier freilich nicht im Zentrum der Untersuchung steht. Zwischen den beiden Stichjahren 1988 und 2016 explodierte Adamskys Datengrundlage zufolge etwa die Zahl der Diözesen von 76 auf 293, die der Pfarreien von rund 6.900 auf 34.800 und die Zahl der Klöster von 22 auf 926. Das gerade auch aufgrund seiner üppigen Details beeindruckende Panorama, das Adamsky von der Geschichte der „nuklearen Orthodoxie“ in Russland zeichnet, lässt im Lichte dieser Zahlen die Frage aufkommen, ob die Geschichte der „nuklearen Orthodoxie“ ein Epiphänomen darstellt: Ist die „nukleare Orthodoxie“ in Russland wirkungslos oder entfaltet sie höchstens marginale Wirkung in Bezug auf die russische Nuklearstrategie, ihre ausführenden Organe und Personen, ihre systemerhaltende Komponenten und ihre politische Steuerung durch die russische Regierung?
Adamsky verneint diese Frage, will zugleich nicht einer Überbetonung des Phänomens das Wort reden, warnt aber vor einer Untergewichtung und bietet in der Tat, was er verspricht: ein nuanciertes Verständnis des Phänomens und seiner Entwicklung über die letzten 30 Jahren hinweg, eine Diskussion von sicherheitspolitischen Implikationen des Einflusses von Religion auf das russische Militär sowie Entwicklungsperspektiven.
Es ist fesselnd zu lesen, wie die russisch-orthodoxe Kirche seit der ersten Phase, im Kontext der mehrjährigen Kernschmelze des sowjetischen Imperiums, galoppierender Irrelevanz des Marxismus-Leninismus und des chaotischen Niedergangs Russlands in den frühen 1990er Jahren, mehr und mehr das geistig-spirituelle Vakuum füllen konnte, das das Personal im russischen Kernwaffenkomplex befallen hatte. Der Antiklerikalismus war zu Sowjetzeiten freilich auch aggressiv im Militär, in Nachrichtendiensten und geheimen bzw. geschlossenen Städten propagiert worden. Daher erscheint das Verlangen dieses Personals nach spiritueller Begleitung im Sinne eines grassroots phenomenon auch in der Rückschau durchaus überraschend. Zugleich priorisierte die russisch-orthodoxe Kirche im Zuge ihrer mehr und mehr ausgeweiteten Penetration der Streitkräfte die Komponenten der russischen Militärmacht nach ihrer Bedeutung für die nationale Sicherheit. Die Nuklearstreitkräfte standen und stehen an erster Stelle. Widerstand aus der russischen nuclear community (selbst aus dem wissenschaftlichen Korps) gegen den dynamisch zunehmenden Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche auf diese community war in den hier untersuchten dreißig Jahren allenfalls ein Randphänomen und weitgehend nicht existent. Die wenigen lautstarken Bedenkenträger wurden durch das Zusammenwirken von Führungs- und Arbeitsebenen auf kirchlicher wie auf community-Ebene offenbar völlig marginalisiert.
Die vielen Episoden über Erst- und Folgekontakte vor allem in den formativen 1990er und frühen 2000er Jahren zwischen Patriarchen, Bischöfen und Priestern der Kirche einerseits sowie Führungspersonal und Angehörigen der Nuklearwaffenlaboratorien, strategischen Raketentruppen, Fernfliegerkräften, strategischen U-Booten, Weltraumstreitkräften und der 12. Hauptdirektion des Verteidigungsministeriums (12. GUMO/Kustodialtruppe für Kernwaffen) andererseits, sind faszinierend zu lesen. Aus der Myriade unzählbarer, über ganz Russland verstreuter Einzelprozesse sowie Kenn- und Vertrauensverhältnisse wählt Adamsky eine eindrucksvolle Bandbreite aus. Als mastermind der Katechese und erstaunlich erfolgreichen Klerikalisierung der russischen Nuklearstreitkräfte von Seiten der Kirche sieht Adamsky den seit 2009 amtierenden Patriarchen von Moskau, Kyrill I. Die Rolle Putins, dessen Frömmigkeit der Autor als erwiesen ansieht, kann gleichzeitig nicht überschätzt werden.
Seit den 1990er Jahren wurden rapide mehr und mehr russisch-orthodoxe Kirchen und Kapellen auf Militärbasen und in geschlossenen Städten und Distrikten eingerichtet, Priester permanent installiert, das Institut der Militärseelsorge der russisch-orthodoxen Kirche wiederanvertraut und unter anderem Laboratorien und Teilstreitkräften Schutzheilige zugewiesen. St. Seraphim von Sarow wurde zum Schutzheiligen aller Angehörigen des russischen Nuklearwaffenkomplexes benannt. Im Kloster von Sarow hatte der NKWD das Büro KB-11 etabliert, aus dem ebenda eines der beiden Hauptzentren der sowjetischen Nuklearwaffenproduktion erwuchs (Arzamas-16, später umbenannt in VNIIEF). Dort wiederum fand noch zu Sowjetzeiten Mitte 1991 die erste wichtige Begegnung statt: zwischen Patriarch Alexius und dem „nuklearen Patriarchen“ und Chef von VNIIEF, Juli Chariton.
Vor allem wurden bis zu den frühen 2000er Jahren religiöses Zeremoniell unter Anleitung russisch-orthodoxer Würdenträger und private Frömmigkeit Teil des täglichen Lebens des Großteils der Angehörigen der nuclear community: Namenstage von Schutzheiligen, Begründungstage militärischer Großverbände (etwa der 4. Dezember für die strategischen Raketentruppen) oder Graduiertenfeiern an Kaderschulen wurden orthodox-rituell begangen; Bomber und U-Boote erhielten Heiligennamen; Priester wurden Teil der U-Boot-Crews und segneten Liegenschaften, Testgebiete, militärisches Gerät, Nuklearwaffensysteme und Übungen; Fernflieger- und Weltraumtruppen führten Kreuz- und Reliquienprozessionen durch, mitunter wurden Altoffiziere Kleriker. Überhaupt legt Adamsky nahe, dass das soldatische Bedürfnis nach Devotionalien russisch-orthodoxer Provenienz wie auch nach priesterlicher Begleitung angesichts der Belastungen des Dienstes in der nuklearen Rolle stark genommen hat.
Die russisch-orthodoxe Kirche hat durch ihre Aktivitäten die nukleare Abschreckung Russlands nicht nur offenbar widerspruchslos legitimiert, sondern auch sehr aktiv zu sakralisieren versucht, indem sie russische Kernwaffen als integralen Bestandteil einer als notwendig beschriebenen mythischen Rolle Russlands zum Schutz der Christenheit aufzuwerten versucht hat. Die Geschichte der russischen Nuklearstreitkräfte hat demnach divine meaning zum Schutz vor Russlands Gegnern. Besonders deutlich artikuliert wurden solche Ideen durch Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche seit der Annexion der Krim, die als eine Art Rücknahme heiliger Erde verschleiert wurde, und der russischen Militärkampagne in Syrien, die in Anlehnung an zaristische Argumentationsweisen des 19. Jahrhunderts als Dienst zum Schutz der dortigen Christenheit – und von Kyrill I. gar als Heiliger Krieg – ausgegeben wurde.
Laut Adamsky verbinden Werte wie nationalistischer Patriotismus, in Militarismus übergehende Hochschätzung des Militärischen (insbesondere der Nuklearstreitkräfte), Zentralismus, Hierarchie und Autoritarismus in einer gelenkten Demokratie sowie eine anti-westliche und anti-liberale Ausrichtung das System Putin, die russisch-orthodoxe Kirche und den neuen esprit de corps in der russischen nuclear community. Die Gedankenwelt insbesondere der Angehörigen dieser community gegen westlich-liberale Subversionsversuche abzuschirmen bzw. sie wider die westliche Welt und auch China verteidigungsbereit zu halten, dies war und ist ein Kernanliegen auch der Spitzen der russisch-orthodoxen Kirche, wie Adamsky anhand prägnanter Zitate aus erstaunlichen Stellungnahmen höchster russisch-orthodoxer Würdenträger herausarbeitet. Adamsky fasst eine ihrer Hauptsorgen prägnant zusammen: „the current Western hybrid subversion aimed at presenting an alien way of life as a universal one and then imposing it on Russia, which would eventually lead to the implosion of the state from within“ (226 f.).
Warum ist das Phänomen der russischen „nuklearen Orthodoxie“ wichtig? Auch wenn dies schwer wissenschaftlich zu belegen sei, argumentiert Adamsky, so sei doch zweifellos die Vorstellung weitverbreitet, dass Glaube und militärnaher Klerus eine positive Wirkung hätten auf Mobilisierung, Rekrutierung, Motivation, Disziplin, Gruppenkohäsion, operationale Wirkeffizienz, Resilienz, Mut im Kampf und die individuelle Fähigkeit, mit Stress, moralischen Dilemmata und Leid umzugehen.
Und was ist laut Adamsky zu erwarten? Die russische „nukleare Orthodoxie“ werde wahrscheinlich die Präsidentschaft Putins überdauern, könnte ein Instrument im bürokratischen Ringen der Streitkräfte um Ressourcenallokation werden und werde wahrscheinlich die Rekrutierung des soldatischen Nachwuchses im Bereich Nuklearstreitkräfte begünstigen. Der Klerus werde wahrscheinlich die Funktionen der Politkommissare aus Sowjetzeiten vollständig ersetzen. Zudem könnte die „nukleare Orthodoxie“ Risikoaffinität oder – im Gegenteil – Risikoaversion bei der Eskalation eines Konfliktes katalysieren. Der Kreml aber werde wahrscheinlich versuchen, sie auszunutzen, um in Abschreckungsmanövern glaubwürdiger agieren und dadurch effektiver politischer Ziele durch Zwang erreichen zu können. Adamsky beleuchtet in seiner Monographie ein bislang wenig verstandenes Phänomen mit sicherheitspolitischer Bedeutung für Europa, dessen Implikationen Historiker, Politikwissenschaftler und Beobachter des Zeitgeschehens vertieft prüfen sollten.
© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Artikel in diesem Heft
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Kriege und Kriegsgefahren im kommenden Jahrzehnt
- Nordkoreas Cyber-Krieg Strategie: Kontinuität und Wandel
- Afghanistan: Droht durch die „Friedensvereinbarung“ eine Vietnamisierung des Konflikts?
- Operative Anpassung von NATO-Streitkräften seit der Krim: Muster und Divergenzen
- Kurzanalysen und Berichte
- Clausewitz, Corbett und Corvetten – Great Power Competition durch die Augen eines Meliers
- Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten
- Was verrät uns das russische Großmanöver Tsentr-2019?
- Literaturbericht
- Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine
- Ergebnisse internationaler strategischer Studie
- Sicherheit in Nordeuropa
- Robert M. Klein/Stefan Lundqvist/Ed Sumangil/Ulrica Pettersson: Baltics Left of Bang. The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence. Stockholm: Strategic Forum, 2019
- Arseny Sivitsky: Belarus-Russia: From a Strategic Deal to an Integration Ultimatum. Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute (FPRI), Dezember 2019
- Maria Domańska/Szymon Kardaś/Marek Menkiszak/Jadwiga Rogoża/Andrzej Wilk/Iwona Wiśniewska/Piotr Żochowski: Fortress Kaliningrad. Ever Closer to Moscow. Warschau: Center for Eastern Studies (OSW), November 2019
- Verteidigung im Rahmen der NATO
- Claudia Major: Die Rolle der Nato für Europas Verteidigung – Stand und Optionen zur Weiterentwicklung aus deutscher Perspektive. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019
- Colin Smith/Jim Townsend: Not enough Maritime Capability. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov: European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Center for Defence and Security/Konrad Adenauer Foundation, 2019
- Russland
- Susanne Oxenstierna/Fredrik Westerlund/Gudrun Persson/Jonas Kjellén/Nils Dahlqvist/Johan Norberg/Martin Goliath/Jakob Hedenskog/Tomas Malmlöf/Johan Engvall: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, Stockholm: FOI, Dezember 2019
- Finish Ministry of Defence: Russia of Power. Helsinki, Juni 2019
- Pavel Baev: Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and False Posturing. Paris: Ifri, August 2019
- Philip Hanson: Russian Economic Policy and the Russian Economic System. Stability versus Growth. London: Chatham House, Dezember 2019
- Globale Großmachtrivalität
- Angela Stent: Russia and China. Axis of Revisionists? Washington, D.C.: The Brookings Institution, February 2020
- Bruce Jones: China and the return of great power strategic competition. Washington, D.C.: The Brookings Institution, Februar 2020
- Chris Dougherty: Why America Needs a New Way of War. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Patrick M. Cronin/Ryan Neuhard: Total Competition. China’s Challenge in the South China Sea. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Januar 2020
- Chinas Belt and Road Initiative und Europa
- Frank Jüris: The Talsinki Tunnel. Channeling Chinese Interests into the Baltic Sea. Talllin: ICDS, Dezember 2019
- Steven Blockmans/Weinian Hu: Systemic Rivalry and Balancing Interests: Chinese Investment meets EU Law on the Belt and Road. Brüssel: CEPS, März 2019
- Cyberspace
- Lillian Ablon/Anika Binnendijk/Quentin E. Hodgson/Bilyana Lilly/Sasha Romanosky/David Senty/Julia A. Thompson: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., Juni 2019
- Beyza Unal: Cybersecurity of NATO’s Space-based Strategic Assets. London: Chatham House, Juli 2019
- Jean-Christophe Noël: What Is Digital Power? Paris: Ifri, November 2019
- Elsa B. Kania: Securing Our 5G Future. The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Buchbesprechungen
- Rob de Wijk: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung: wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019, 438 Seiten
- Sergio Fabbrini, 2019: Europe’s Future. Decoupling and reforming. Cambridge: Cambridge University Press, 180 Seiten
- Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2019, 376 Seiten
- David A. Haglund: The US “Culture Wars” and the Anglo-American Special Relationship. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, 254 Seiten
- Sebastian Kaempf: Saving Soldiers or Civilians? Casualty-Aversion versus Civilian Protection in Asymmetric Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 302 Seiten
- Bildnachweise
- Translated Articles (e-only)
- North Korea’s Evolving Cyber Strategies: Continuity and Change
Artikel in diesem Heft
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Kriege und Kriegsgefahren im kommenden Jahrzehnt
- Nordkoreas Cyber-Krieg Strategie: Kontinuität und Wandel
- Afghanistan: Droht durch die „Friedensvereinbarung“ eine Vietnamisierung des Konflikts?
- Operative Anpassung von NATO-Streitkräften seit der Krim: Muster und Divergenzen
- Kurzanalysen und Berichte
- Clausewitz, Corbett und Corvetten – Great Power Competition durch die Augen eines Meliers
- Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten
- Was verrät uns das russische Großmanöver Tsentr-2019?
- Literaturbericht
- Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine
- Ergebnisse internationaler strategischer Studie
- Sicherheit in Nordeuropa
- Robert M. Klein/Stefan Lundqvist/Ed Sumangil/Ulrica Pettersson: Baltics Left of Bang. The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence. Stockholm: Strategic Forum, 2019
- Arseny Sivitsky: Belarus-Russia: From a Strategic Deal to an Integration Ultimatum. Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute (FPRI), Dezember 2019
- Maria Domańska/Szymon Kardaś/Marek Menkiszak/Jadwiga Rogoża/Andrzej Wilk/Iwona Wiśniewska/Piotr Żochowski: Fortress Kaliningrad. Ever Closer to Moscow. Warschau: Center for Eastern Studies (OSW), November 2019
- Verteidigung im Rahmen der NATO
- Claudia Major: Die Rolle der Nato für Europas Verteidigung – Stand und Optionen zur Weiterentwicklung aus deutscher Perspektive. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019
- Colin Smith/Jim Townsend: Not enough Maritime Capability. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov: European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Center for Defence and Security/Konrad Adenauer Foundation, 2019
- Russland
- Susanne Oxenstierna/Fredrik Westerlund/Gudrun Persson/Jonas Kjellén/Nils Dahlqvist/Johan Norberg/Martin Goliath/Jakob Hedenskog/Tomas Malmlöf/Johan Engvall: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, Stockholm: FOI, Dezember 2019
- Finish Ministry of Defence: Russia of Power. Helsinki, Juni 2019
- Pavel Baev: Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and False Posturing. Paris: Ifri, August 2019
- Philip Hanson: Russian Economic Policy and the Russian Economic System. Stability versus Growth. London: Chatham House, Dezember 2019
- Globale Großmachtrivalität
- Angela Stent: Russia and China. Axis of Revisionists? Washington, D.C.: The Brookings Institution, February 2020
- Bruce Jones: China and the return of great power strategic competition. Washington, D.C.: The Brookings Institution, Februar 2020
- Chris Dougherty: Why America Needs a New Way of War. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Patrick M. Cronin/Ryan Neuhard: Total Competition. China’s Challenge in the South China Sea. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Januar 2020
- Chinas Belt and Road Initiative und Europa
- Frank Jüris: The Talsinki Tunnel. Channeling Chinese Interests into the Baltic Sea. Talllin: ICDS, Dezember 2019
- Steven Blockmans/Weinian Hu: Systemic Rivalry and Balancing Interests: Chinese Investment meets EU Law on the Belt and Road. Brüssel: CEPS, März 2019
- Cyberspace
- Lillian Ablon/Anika Binnendijk/Quentin E. Hodgson/Bilyana Lilly/Sasha Romanosky/David Senty/Julia A. Thompson: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., Juni 2019
- Beyza Unal: Cybersecurity of NATO’s Space-based Strategic Assets. London: Chatham House, Juli 2019
- Jean-Christophe Noël: What Is Digital Power? Paris: Ifri, November 2019
- Elsa B. Kania: Securing Our 5G Future. The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Buchbesprechungen
- Rob de Wijk: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung: wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019, 438 Seiten
- Sergio Fabbrini, 2019: Europe’s Future. Decoupling and reforming. Cambridge: Cambridge University Press, 180 Seiten
- Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2019, 376 Seiten
- David A. Haglund: The US “Culture Wars” and the Anglo-American Special Relationship. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, 254 Seiten
- Sebastian Kaempf: Saving Soldiers or Civilians? Casualty-Aversion versus Civilian Protection in Asymmetric Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 302 Seiten
- Bildnachweise
- Translated Articles (e-only)
- North Korea’s Evolving Cyber Strategies: Continuity and Change

