Reviewed Publication:
de Wijk Rob De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam Uitgeverij Balans 2019 1 438
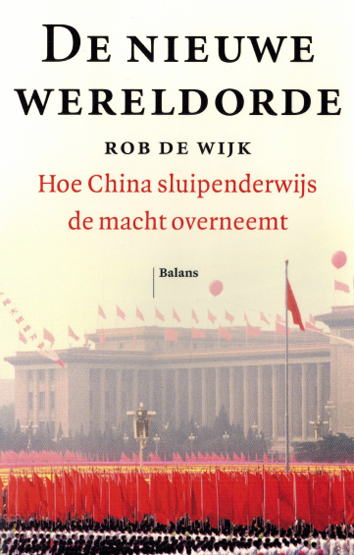
Es ist nicht das Ende der Geschichte (Francis Fukuyama) und auch nicht der Zusammenprall der Kulturen (Samuel Huntington), sondern der Kampf um die Weltordnung, der die moderne Politik beschäftigt. Rob de Wijk, Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Leiden und Gründer des Den Haag Centrums für Strategische Studien (HCSS), geht diese Frage in aller Klarheit an. Die zentrale Frage lautet: „Wir Westlinge haben die Weltordnung mit unseren eignen Händen gebaut. Die Weltordnung hat uns zu dem gemacht, was wir sind: frei, wohlhabend, demokratisch. Und diese Weltordnung wird [durch die Ankunft des autoritären Ordnungsmodells Chinas] verschrottet, was per Definition auf Kosten der Welt, die wir uns selbst geschaffen haben, geht“ (S. 8). Das Buch ist ein vehementes Plädoyer, diesen Systemwettbewerb klar zu erkennen, anzunehmen und ihm zu begegnen. Ansonsten könnte, im Sinne des Aufstiegs und Niedergangs von Nationen (Paul Kennedy) die westliche Welt und ihr Ordnungsmodell ein Interregnum sein, das durch eine autoritäre Variante eines globalen Kapitalismus mit lokalen protektionistischen Elementen abgelöst wird: der Weltordnung mit chinesischen Charakteristika. Das Buch gliedert sich in drei große Teile:
Das erste Kapitel beschreibt die westliche Weltordnung. Erschien sie nach dem Wende-Jahr 1989 als eine US-dominierte, unipolare Welt, so wurde vor allem nach der Jahrtausendwende immer deutlicher, dass 1989 nicht als Sieg der liberalen Weltordnung zu begreifen ist, sondern vielmehr den Beginn des Untergangs der westlichen Welt als einer Welt mit universellen Werten eingeläutet hat. Diese westliche Ordnung vereinte historisch die geopolitische Sicht mit einem Wertekonsens, der sich aus Erfahrungen der Geschichte, politischen Entwicklungen, insbesondere Liberalismus und Demokratie, und dem universellen Konzept der Menschenrechte entwickelt hatte. Aus diesem ganzheitlichen Anspruch heraus entwickelte sich auch die Kritik an der westlichen Leitkultur und dem politischen System, das heute in den osteuropäischen Staaten, aber auch in den USA unter Trump aufscheint. Offene Märkte und kollektive Sicherheitssysteme verlieren zunehmend an Wert und an Selbstverständnis. Russland verabschiedet sich von diesem klassischen Westen, träumt von einem eurasischen Europa, baut hardpower mangels Verfügbarkeit von softpower auf und unterminiert im Konzert mit Trumps Amerika die westlichen Werte, was die Ankunft der chinesischen Weltordnung massiv erleichtert.
Das zweite Kapitel widmet sich Chinas Ankunft und der Frage, welche Elemente der westlichen Weltordnung Bestand haben könnten und welche China umgestalten will. An erster Stelle wird der Begriff der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Modernität als zentrales Stichwort für die chinesische Entwicklung herausgearbeitet. Ökonomisch ist das Land im westlichen System angekommen. Aber im Sinne der kulturell-religiösen und historischen Tradition organisiere es sich stark an Hierarchie und Ordnung, begründet in den konfuzianischen Überlieferungen. Damit gewinne es einen Identitätsvorteil gegenüber den westlichen, immer mehr kulturell- und identitätsmäßig zerfasernden Ordnungen. Der Westen müsse sich damit auseinandersetzen, dass China in Bezug auf Modernität und seinem Platz in der Welt in langen Entwicklungslinien denkt – ganz anders als bei uns. Dabei geht es China darum, die historische, dem Land angeblich zustehende und angemessene Position in der Welt wieder einzunehmen. Damit verbunden ist eine Sicherheitsordnung, die auf der klassischen chinesischen Tradition der tributären Systeme aufbaut und die den Handel als Mittel begreift, andere Länder zu erobern. In diesem Zusammenhang rückt der Verfasser die sogenannten „Kernbelange“ Chinas ins Zentrum der Betrachtung: seinen internationalen führenden Status, eine umfassende neue territoriale Ordnung im eigenen Interessengebiet vorzunehmen, eine Friedensmacht im Sinne des Tributsystems und der Handelsstrategie (neue Seitenstraße) zu werden und die Absicherung dieser Politik durch eine Kriegsmacht im Sinne eines modernen Militärs.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Vorstellungen Beijings zur neuen, chinesisch geprägten Weltordnung. Intern besteht diese aus dem Wohlstandsversprechen, extern ist sie durch eine starke geopolitische Ausrichtung gekennzeichnet. Ökonomische Instrumente sind wichtig zur Verfolgung politischer Ziele. Insbesondere kann das Recht, Zugang zum riesigen chinesischen Markt zu erhalten, als Druckmittel genutzt werden, um Wohlverhalten zu erzwingen. Dieser Ansatz stehe in der chinesischen Tradition, andere Länder tributär zu vereinnahmen. Die früher gehegte Vorstellung, die Mitwirkung am internationalen Handel würde in China langfristig das autoritäre System liberalisieren, scheine sich nicht zu erfüllen. Vielmehr werde das liberalisierte Freihandelssystem genutzt, um an Technologien heranzukommen und um über Handelbeziehungen massiven Einfluss in anderen Ländern zu erhalten. Dabei versuche die Regierung in Beijing Einfluss auszuüben, indem sie eigene internationale Institutionen und Systeme des internationalen Austausches schafft, die China und nicht die USA kontrolliert. Prominentes Beispiel sei die Strategie „Made in China 2025“ oder die „One Belt One Road“ Initiative (die Neue Seidenstraße), ergänzt um Institutionen wie die „Asian Infrastructure Investment Bank“ (AIIB). China verfolge zudem einen verbundenen Ansatz, um die „Vierte industrielle Revolution“ nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Erleichtert wird dies durch die Schwäche des Westens, der in geradezu einzigartiger Weise Koordination, Kooperation und Strategie vermissen lässt. Was China dabei hilft, ist die Konfrontation des Westens mit Russland. Dadurch orientiere sich Moskau zunehmend nach Osten und werde zu einem relevanten Technologielieferanten Chinas im Bereich von Rüstung und Weltraum.
Rob de Wijk zieht hieraus folgende Schlussfolgerungen:
China wird zunehmend ein tributäres System aufbauen, um Kontrolle über andere Staaten, vor allem in seiner Nähe, aufzubauen.
Die internationalen Beziehungen werden stark von direkter Reziprozität dominiert werden. Der von China immer wieder auf dem Feld des globalen Handels erklärte Multilateralismus wird auf politischer Ebene durch forcierten Bilateralismus ergänzt, der insbesondere die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auseinanderzudividieren droht.
Die Handelsbeziehungen werden im Sine der Vorstellung von Nullsummenspielen noch merkantilistischer als bisher; dabei spielen die Fähigkeit Chinas – auch über seine Staatsbetriebe – Handelsbeziehungen direkt zu steuern, eine wichtige Rolle.
Die globale institutionelle Landschaft wird sich unumkehrbar in Richtung chinesischer Charakteristika verändern; die internationalen Institutionen werden ihre westliche Prägung und Prägekraft verlieren. Damit einher geht ein Abschied von bestimmten Universalitätsprinzipien, die der Westen geprägt hat, beispielsweise denen der Menschenrechte oder von Pluralismus.
Einflusssphären und Blockbildungen werden wichtiger, was bereits in Afrika und in den peripheren Staaten Europas sichtbar wird.
Sicherheitspositionen werden fließend, weil völkerrechtliche Positionen sich politisch-situativ schnell verändern können, auch unter dem Eindruck instabiler wirtschaftlicher Interessenlagen. Die Sanktionspolitik gegen Russland oder die steten Ungewissheiten im Handelskrieg zwischen den USA und China sind prominente Beispiele.
Liberale Werte, Demokratie und Menschenrechte verlieren zunehmend ihre bisherige politische Stellung im internationalen Diskurs.
Die Welt fällt zurück auf klassische Ausweise nationaler Identität, was wiederum nationale Egoismen befördert.
Die Welt wird nach dem Interregnum des Westens nicht unbedingt unsicherer.
Nukleare Abschreckung als konstitutiver Teil der Sicherheitspolitik – national oder im Bündnis – wird wichtiger.
Rob de Wijk hat mit der Arbeit ein von politischen Entscheidungsträgern dringend zu lesendes Werk vorgelegt, das alle im Westen aufruft, sich strategisch neu aufzustellen, um die Herausforderungen anzunehmen und damit für China ein glaubhafter und einiger Ansprechpartner zu sein – gerade um das beschleunigte Entstehen eines Machtvakuums zu verhindern. Die Arbeit verdeutlich, wie stark ein solches – klassisch militärisch, heute kulturell, ökonomisch, politisch – durch neue Länder gefüllt wird. Fragte sich Henry Kissinger noch vor 25 Jahren, ob der Westen die Fehler mit China wiederholen könnte, die er mit Deutschland im Vorfeld des Ersten Weltkrieg gemacht hatte, nämlich es nicht unter den großen Nationen zu akzeptieren, so muss heute die Analyse anders lauten: Will der Westen mutwillig seine prägende Position schneller als notwendig verlieren, will er seine Prägekraft – seine softpower – offensiv einsetzt? Nachdem vor 100 Jahren England aufgrund von Überdehnung und Überforderung seine Hegemonialstellung an die USA verloren hatte, wollen die USA heute diese nunmehr fast freiwillig an China abgeben?
Rob de Wijks brillante Analyse der neuen Weltordnung mit chinesischen Charakteristika und der damit einhergehenden Herausforderungen für den Westen sollte hoffentlich auch bald in deutscher Sprache vorliegt. Das Buch fällt in eine Zeit, in welcher der neue Systemwettbewerb nicht so einfach wie der alte gewonnen werden kann – der Erfolg von 1989 trügt. Global ist die Verfassung der Freiheit auf dem Rückzug, gerade auch auf ökonomischem Gebiet, und Schuld trifft auch den Westen: Der klassische Freihandel gerät zunehmend infolge einer Maxime der Sicherung von globalen Wertschöpfungssicherung unter Druck – und dies ist nicht eine Folge von Chinas Ankunft in der Weltwirtschaft und -politik, sondern auch neuer Handelsparadigmen, stark durch Produktions- und Logistiktechnologien bestimmt, und durch Complianceregeln, die Unternehmen zwingen, ihre Lieferketten zu kontrollieren.
© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Kriege und Kriegsgefahren im kommenden Jahrzehnt
- Nordkoreas Cyber-Krieg Strategie: Kontinuität und Wandel
- Afghanistan: Droht durch die „Friedensvereinbarung“ eine Vietnamisierung des Konflikts?
- Operative Anpassung von NATO-Streitkräften seit der Krim: Muster und Divergenzen
- Kurzanalysen und Berichte
- Clausewitz, Corbett und Corvetten – Great Power Competition durch die Augen eines Meliers
- Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten
- Was verrät uns das russische Großmanöver Tsentr-2019?
- Literaturbericht
- Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine
- Ergebnisse internationaler strategischer Studie
- Sicherheit in Nordeuropa
- Robert M. Klein/Stefan Lundqvist/Ed Sumangil/Ulrica Pettersson: Baltics Left of Bang. The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence. Stockholm: Strategic Forum, 2019
- Arseny Sivitsky: Belarus-Russia: From a Strategic Deal to an Integration Ultimatum. Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute (FPRI), Dezember 2019
- Maria Domańska/Szymon Kardaś/Marek Menkiszak/Jadwiga Rogoża/Andrzej Wilk/Iwona Wiśniewska/Piotr Żochowski: Fortress Kaliningrad. Ever Closer to Moscow. Warschau: Center for Eastern Studies (OSW), November 2019
- Verteidigung im Rahmen der NATO
- Claudia Major: Die Rolle der Nato für Europas Verteidigung – Stand und Optionen zur Weiterentwicklung aus deutscher Perspektive. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019
- Colin Smith/Jim Townsend: Not enough Maritime Capability. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov: European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Center for Defence and Security/Konrad Adenauer Foundation, 2019
- Russland
- Susanne Oxenstierna/Fredrik Westerlund/Gudrun Persson/Jonas Kjellén/Nils Dahlqvist/Johan Norberg/Martin Goliath/Jakob Hedenskog/Tomas Malmlöf/Johan Engvall: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, Stockholm: FOI, Dezember 2019
- Finish Ministry of Defence: Russia of Power. Helsinki, Juni 2019
- Pavel Baev: Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and False Posturing. Paris: Ifri, August 2019
- Philip Hanson: Russian Economic Policy and the Russian Economic System. Stability versus Growth. London: Chatham House, Dezember 2019
- Globale Großmachtrivalität
- Angela Stent: Russia and China. Axis of Revisionists? Washington, D.C.: The Brookings Institution, February 2020
- Bruce Jones: China and the return of great power strategic competition. Washington, D.C.: The Brookings Institution, Februar 2020
- Chris Dougherty: Why America Needs a New Way of War. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Patrick M. Cronin/Ryan Neuhard: Total Competition. China’s Challenge in the South China Sea. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Januar 2020
- Chinas Belt and Road Initiative und Europa
- Frank Jüris: The Talsinki Tunnel. Channeling Chinese Interests into the Baltic Sea. Talllin: ICDS, Dezember 2019
- Steven Blockmans/Weinian Hu: Systemic Rivalry and Balancing Interests: Chinese Investment meets EU Law on the Belt and Road. Brüssel: CEPS, März 2019
- Cyberspace
- Lillian Ablon/Anika Binnendijk/Quentin E. Hodgson/Bilyana Lilly/Sasha Romanosky/David Senty/Julia A. Thompson: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., Juni 2019
- Beyza Unal: Cybersecurity of NATO’s Space-based Strategic Assets. London: Chatham House, Juli 2019
- Jean-Christophe Noël: What Is Digital Power? Paris: Ifri, November 2019
- Elsa B. Kania: Securing Our 5G Future. The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Buchbesprechungen
- Rob de Wijk: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung: wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019, 438 Seiten
- Sergio Fabbrini, 2019: Europe’s Future. Decoupling and reforming. Cambridge: Cambridge University Press, 180 Seiten
- Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2019, 376 Seiten
- David A. Haglund: The US “Culture Wars” and the Anglo-American Special Relationship. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, 254 Seiten
- Sebastian Kaempf: Saving Soldiers or Civilians? Casualty-Aversion versus Civilian Protection in Asymmetric Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 302 Seiten
- Bildnachweise
- Translated Articles (e-only)
- North Korea’s Evolving Cyber Strategies: Continuity and Change
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Kriege und Kriegsgefahren im kommenden Jahrzehnt
- Nordkoreas Cyber-Krieg Strategie: Kontinuität und Wandel
- Afghanistan: Droht durch die „Friedensvereinbarung“ eine Vietnamisierung des Konflikts?
- Operative Anpassung von NATO-Streitkräften seit der Krim: Muster und Divergenzen
- Kurzanalysen und Berichte
- Clausewitz, Corbett und Corvetten – Great Power Competition durch die Augen eines Meliers
- Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten
- Was verrät uns das russische Großmanöver Tsentr-2019?
- Literaturbericht
- Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine
- Ergebnisse internationaler strategischer Studie
- Sicherheit in Nordeuropa
- Robert M. Klein/Stefan Lundqvist/Ed Sumangil/Ulrica Pettersson: Baltics Left of Bang. The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence. Stockholm: Strategic Forum, 2019
- Arseny Sivitsky: Belarus-Russia: From a Strategic Deal to an Integration Ultimatum. Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute (FPRI), Dezember 2019
- Maria Domańska/Szymon Kardaś/Marek Menkiszak/Jadwiga Rogoża/Andrzej Wilk/Iwona Wiśniewska/Piotr Żochowski: Fortress Kaliningrad. Ever Closer to Moscow. Warschau: Center for Eastern Studies (OSW), November 2019
- Verteidigung im Rahmen der NATO
- Claudia Major: Die Rolle der Nato für Europas Verteidigung – Stand und Optionen zur Weiterentwicklung aus deutscher Perspektive. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019
- Colin Smith/Jim Townsend: Not enough Maritime Capability. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov: European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Center for Defence and Security/Konrad Adenauer Foundation, 2019
- Russland
- Susanne Oxenstierna/Fredrik Westerlund/Gudrun Persson/Jonas Kjellén/Nils Dahlqvist/Johan Norberg/Martin Goliath/Jakob Hedenskog/Tomas Malmlöf/Johan Engvall: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, Stockholm: FOI, Dezember 2019
- Finish Ministry of Defence: Russia of Power. Helsinki, Juni 2019
- Pavel Baev: Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and False Posturing. Paris: Ifri, August 2019
- Philip Hanson: Russian Economic Policy and the Russian Economic System. Stability versus Growth. London: Chatham House, Dezember 2019
- Globale Großmachtrivalität
- Angela Stent: Russia and China. Axis of Revisionists? Washington, D.C.: The Brookings Institution, February 2020
- Bruce Jones: China and the return of great power strategic competition. Washington, D.C.: The Brookings Institution, Februar 2020
- Chris Dougherty: Why America Needs a New Way of War. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Patrick M. Cronin/Ryan Neuhard: Total Competition. China’s Challenge in the South China Sea. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Januar 2020
- Chinas Belt and Road Initiative und Europa
- Frank Jüris: The Talsinki Tunnel. Channeling Chinese Interests into the Baltic Sea. Talllin: ICDS, Dezember 2019
- Steven Blockmans/Weinian Hu: Systemic Rivalry and Balancing Interests: Chinese Investment meets EU Law on the Belt and Road. Brüssel: CEPS, März 2019
- Cyberspace
- Lillian Ablon/Anika Binnendijk/Quentin E. Hodgson/Bilyana Lilly/Sasha Romanosky/David Senty/Julia A. Thompson: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., Juni 2019
- Beyza Unal: Cybersecurity of NATO’s Space-based Strategic Assets. London: Chatham House, Juli 2019
- Jean-Christophe Noël: What Is Digital Power? Paris: Ifri, November 2019
- Elsa B. Kania: Securing Our 5G Future. The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019
- Buchbesprechungen
- Rob de Wijk: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung: wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019, 438 Seiten
- Sergio Fabbrini, 2019: Europe’s Future. Decoupling and reforming. Cambridge: Cambridge University Press, 180 Seiten
- Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2019, 376 Seiten
- David A. Haglund: The US “Culture Wars” and the Anglo-American Special Relationship. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, 254 Seiten
- Sebastian Kaempf: Saving Soldiers or Civilians? Casualty-Aversion versus Civilian Protection in Asymmetric Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 302 Seiten
- Bildnachweise
- Translated Articles (e-only)
- North Korea’s Evolving Cyber Strategies: Continuity and Change

