Zusammenfassung
Der tiefgreifende Wandel in der Medienlandschaft stellt auch die Österreichische Nationalbibliothek vor die strategische Herausforderung der Transformation zur „Teaching Library“. Der digitale Umbruch macht es erforderlich, nicht nur Wissen bereitzustellen, sondern Leser*innen auch dabei zu unterstützen, dieses Wissen zu finden, ihnen Werkzeuge für ihren Weg durch den Mediendschungel in die Hand zu geben und Know-how für das Erkennen von seriösen Informationsquellen und die Nutzung neuer Technologien zu vermitteln. Diese strategische Neupositionierung neben ihrer Archivfunktion haben Bibliotheken weltweit zu bewältigen. Mit dieser Zielsetzung wurde 2022 das Center für Informations- und Medienkompetenz organisatorisch in der Österreichischen Nationalbibliothek verankert. Im vorliegenden Beitrag werden das Konzept und das Programm des Centers für Informations- und Medienkompetenz vorgestellt und über die Erfahrungen nach den ersten beiden Jahren des Betriebs berichtet.
Abstract
The profound transformation in the media landscape also confronts the Austrian National Library with the strategic challenge of transforming into a teaching library. The digital upheaval makes it necessary not only to provide knowledge but also to support readers in finding this knowledge, to give them tools for their journey through the media jungle, and to impart know-how for recognizing reliable information sources and using new technologies. Libraries worldwide must tackle this strategic repositioning alongside their archival function. With this goal in mind, the Center of Information and Media Literacy was organizationally anchored in the Austrian National Library in 2022. This article presents the concept and program of this Center and reports on the experiences after the first two years of operation.
1 Einleitung
Der tiefgreifende Wandel in der Medienlandschaft von Print über Digital hin zur Künstlichen Intelligenz (KI) und die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen versteht die Österreichische Nationalbibliothek als Aufforderung zur strategischen Neupositionierung ihres Bildungsauftrags. Mittelfristiges Ziel ist die Etablierung als Bildungspartnerin in Form einer Teaching Library – einem Bibliothekskonzept, das sich dem Teilen von Wissen mit Interessierten verschrieben hat. Die Aufgabe der „Vermittlung“ in weiterem Sinne, ist auch in der Rechtsgrundlage der Österreichischen Nationalbibliothek, der „Bibliotheksordnung“, enthalten:
Die zielgruppenspezifische, zeitgemäße und innovative Vermittlungsarbeit geht auf aktuelle künstlerische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen ein und ist bestrebt, insbesondere die Teilhabe von Kindern, Jugendlichen, in Österreich lebenden Migrantinnen/Migranten und ethnischen Minderheiten gezielt zu erweitern sowie den barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderungen zu verbessern.[1]
Über Jahrhunderte war das Erwerben, Bereitstellen und Archivieren von Büchern und Medien die Kernaufgabe von Bibliotheken. Der digitale Umbruch macht es erforderlich, nicht nur Wissen bereitzustellen, sondern die Benutzer*innen und Leser*innen auch dabei zu unterstützen, dieses Wissen zu finden und mithilfe neuer Technologien zu nutzen, ihnen Werkzeuge für ihren Weg durch den Mediendschungel in die Hand zu geben und Know-how für das Erkennen von seriösen Informationsquellen zu vermitteln. Diese strategische Neupositionierung neben ihrer Archivfunktion haben Bibliotheken weltweit zu bewältigen, denn sie sind der Garant für verlässliche Quellen. In der Österreichischen Nationalbibliothek hat diese gesamtgesellschaftliche Tendenz auch in der publizierten Vision 2035[2] sowie in den der Vision folgenden, jeweils 5-jährigen Strategieperioden Niederschlag gefunden. Der besondere Fokus in Vision und Strategieplanung gilt dabei der zielgruppenspezifischen Vermittlung: dem Ausbau von spannenden, interdisziplinären Angeboten für Kinder und Jugendliche, der stärkeren Vernetzung mit Schulen sowie der Aufbereitung und Präsentation von Inhalten für Studierende und Forscher*innen. Die Österreichische Nationalbibliothek tritt dabei nicht in Konkurrenz zu den Universitäten, sondern versteht ihr Bildungsangebot, basierend auf ihren einzigartigen Beständen, als Ergänzung.
Mit dieser Zielsetzung wurde 2020 von der Österreichischen Nationalbibliothek die Entscheidung getroffen, die neue Aufgabe auch räumlich und organisatorisch zu verankern. Im Herbst 2022 war es schließlich so weit, das Center für Informations- und Medienkompetenz (kurz „CIM“) öffnete unter dem Motto „Mehr Wissen“ seine Pforten. Entstanden ist innerhalb des Bibliotheksbereichs Heldenplatz der Österreichischen Nationalbibliothek ein fünf Seminarräume umfassendes Wissenszentrum, das Platzressourcen für die langfristige Weiterentwicklung zur Teaching Library bietet.

Entkernung und Neugestaltung des gesamten Untergeschosses und Einbau des Centers für Informations- und Medienkompetenz 2022, ©ÖNB
2 Das Konzept
Kurz zusammengefasst könnte man das inhaltliche Konzept des CIM auf folgenden Nenner bringen: elektronisch, rasch und quellenfundiert recherchieren lernen und sich dabei nicht nur auf Google verlassen müssen. Anspruch des CIM ist es, mittels vielfältiger Schulungen und individueller Rechercheunterstützung eine gut etablierte Anlaufstelle für formelles und informelles Lernen zu werden. Das Trainingsprogramm wird laufend reevaluiert und angepasst, um aktuelle Trends und gesellschaftliche Fragestellungen aufzugreifen: Stichworte wie Fake News, Faktenchecks, Fake Science und KI. Dem Ziel der Aktualität und Praxisrelevanz folgend werden zudem Kooperationen mit Bildungspartner*innen aus dem universitären Bereich, der Erwachsenenbildung und Schulen eingegangen, um im regelmäßigen Austausch das Angebot bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.
Im vorliegenden Beitrag möchte ich einen Überblick über das aktuelle Trainingsprogramm der Österreichischen Nationalbibliothek für Studierende, Schüler*innen und die allgemeine interessierte Öffentlichkeit geben – und natürlich auch über die Erfahrungen und Nachjustierungen nach den ersten zwei Jahren des Betriebs berichten.
3 Einrichtung und Organisation
In einem einjährigen Bauvorhaben wurde das gesamte öffentlich zugängliche Tiefparterre entkernt, mit neuer Haus- und Klimatechnik (Lüftung, Klima, Heizung, Beleuchtung) versehen und zeitgemäßen Anforderungen entsprechend ausgestattet: So erstrahlen nicht nur der Großformatelesesaal, die Buchausgabe und die Recherchezone in neuem Design, es wurden außerdem flächendeckendes WLAN sowie ein Self-Service-Mikroformen-Corner und die IT-Infrastruktur für Leser*innen auf einem zeitgemäßen Stand gebracht. Neben BYO-Device-Rechercheplätze mit Stromanschlüssen und Lademöglichkeiten werden den Leser*innen auch weiterhin fest installierte Rechercheplätze mit zentral verwalteten Recherche-PCs zur Verfügung gestellt.
Das CIM wurde im Zuge dieses Bauvorhabens im Untergeschoß des Bibliotheksbereichs Heldenplatz baulich in das bestehende räumliche Gesamtkonzept integriert und mit aktueller IT-Infrastruktur für Präsenz- und Online-Formate sowie hybride Wissensvermittlung mit variabel einsetzbarer Möblierung und flexibler Raumnutzung ausgestattet. Die technische Infrastruktur umfasst in den Seminarräumen Raummikrofone und remote steuerbare Konferenzkameras sowie je nach Raumsetting neben einer Einfach-Projektion (mittels Full-HD-Projektoren) auch die Möglichkeit einer Doppel-Projektion, mit der zwei unterschiedliche Inhalte innerhalb eines Raumes projiziert werden können. Alle Teilnehmer*innenplätze sind entweder für flexible Settings mit Notebooks (inkl. zentraler Notebook-Ladestationen) oder für ein Classroom-Setting mit fix installierten Schulungs-PCs ausgestattet. Großer Wert wurde hier auf die Umsetzung einer zentralen Verwaltung aller IT-Arbeitsplätze gelegt. Ergänzt wird die Ausstattung durch zwei vollwertig ausgestattete Webinar-Vortragsplätze mit regulierbarer Webinarbeleuchtung (Farbton und Helligkeit) sowie Richtmikrofone für eine optimale Übertragungsqualität. Ein mobiles All-In-One-Webkonferenzsystem (Video, Audio, digital Whiteboard, Direktprojektion, BYO-Device und BYO-Meeting), mit dem nicht nur Präsenzveranstaltungen optimal unterstützt und umgesetzt, sondern auch nahtlos externe Teilnehmer*innen in Veranstaltungen eingebunden werden können, unterstützt neben großflächiger Whiteboardflächen die Vermittlung.

Recherchetrainings in Kleingruppen für Studierende im Center für Informations- und Medienkompetenz, ©ÖNB
Organisatorisch ist das CIM der Hauptabteilung Benützung und Information zugeordnet. Die akademisch ausgebildeten Informationsexpert*innen der Abteilung Kundenservices, Leserberatung und Schulungsmanagement sind für die inhaltliche Konzeption des Programms und die Durchführung der Trainings verantwortlich.
Facts
9 Trainer*innen
4 Seminarräume mit Platzkapazitäten für jeweils 22 bis 40 Personen
1 Webinar- und Webkonferenzraum mit zwei Vortragsplätzen
Empfangs- und Anmeldebereich
Integration in die räumliche Infrastruktur für Konferenzen und Veranstaltungen
Kapazitäten 2024/25
Personelle Ressourcen für rund 300 Trainings pro Jahr
60 terminlich fixierte Programmschulungen
240 frei vereinbarte Termine für Studierende und Schulklassen
Bis 2027 wird eine 30 %-ige Steigerung der Termine angestrebt.
4 Gewusst wie recherchieren – das Programm
Im Rahmen des neuen strategischen Schwerpunkts Teaching Library hat die Österreichische Nationalbibliothek ein vielfältiges Programm entwickelt, das grundlegende und unmittelbar anwendbare Kompetenzen für einen effizienten Umgang mit digitalen Informationsquellen, KI als auch analogen Medien, vermitteln soll.
Das Kursprogramm wird halbjährlich aktualisiert und ist besonders praxisnah gestaltet. Im Fokus der Trainings steht das Kennenlernen und Nutzen der vielfältigen digitalen Bestände der Österreichischen Nationalbibliothek mit Schwerpunkt auf die Unique Selling Points des Hauses: Zum Beispiel ÖNB Digital, dem bestandsübergreifenden Portal, das über 3,2 Mio. digitalisierte Bücher, Fotografien, Grafiken und viele Medientypen mehr umfasst, der Zeitungsdatenbank ANNO, die Volltextsuche in 26 Mio. digitalisierten Seiten historischer Zeitungen und Zeitschriften ermöglicht, oder in den zahlreichen lizensierten Volltextdatenbanken zu unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Der Zugang zu diesen Datenbanken und Quellen ist für die Allgemeinheit remote und kostenfrei möglich, betreffend lizensierte Datenbanken mittels der mit dem Kauf einer Jahres- oder Tageskarte übermittelten Zugangsdaten.
Die Österreichische Nationalbibliothek hat schon vor der Einrichtung des CIM ein vielfältiges Trainingsprogramm angeboten, musste daher bei den Inhalten nicht bei Null starten. Neu ist – neben der deutlichen Ausweitung der angebotenen Termine – ein starker und sich laufend weiterentwickelnder Fokus auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen, ein zielgruppenspezifisches Modulprogramm, Kooperationen mit Bildungspartnern sowie die Etablierung neuer Vermittlungsformate aus dem Bereich des Game Based Learnings. Als Basis der laufenden Weiterentwicklung des Angebots werden eine Analyse der Leserstruktur, Benutzerumfragen sowie Kennzahlen zu häufigen Anfrageinhalten herangezogen.

Jährlich erscheinen zwei Halbjahresprogramme mit terminlich fixierten Trainings für Erwachsene, ©ÖNB
4.1 Programm für Erwachsene
Grundidee war, das Trainingsprogramm zur leichteren Orientierung in folgende Kategorien einzuteilen: ÖNB Start, ÖNB Recherche, ÖNB Spezial und ÖNB Wissensbissen.
4.1.1 ÖNB Start und ÖNB Recherche
ÖNB Start spricht für sich und umfasst die Vermittlung von Grundlagen zur Katalogrecherche und Bibliotheksbenützung. ÖNB Recherche versteht sich darauf aufbauend als Einstieg in die Expertensuche unter Einsatz von gezielten Recherchetechniken in in- und ausländischen Katalogen und digitalen Ressourcen. Die Trainings beider Programmkategorien sind terminlich fixiert, dauern 90 Minuten und werden sowohl online als auch in Präsenz angeboten. Das Angebot richtet sich sowohl an Leser*innen der Bibliothek als auch an Externe und ist online über den Ticketshop und vor Ort buchbar.
Mit Eröffnung des CIM eingeführt wurde die Schiene „Informationskompetenz aus der Praxis“: Es handelt sich dabei um eine grundlegende Einführung in die Recherche nach vor allem digitalen Beständen anhand eines konkreten Themas, zu dem meist auch ein kurzweiliger Bibliotheksblogbeitrag[3] vorliegt. Die Idee dahinter war, dass Lerninhalte anhand eines griffigen Beispiels leichter im Gedächtnis bleiben. Trainer*innen begleiten dabei die ersten Schritte der Leser*innen auf dem Weg zum Rechercheprofi in z. B. einer „Recherche mit Biss“, in welcher dem Vampirmythos des 18. Jahrhunderts nachgespürt wird, sie verfolgen den Klimawandel anhand von historischen Bauernregeln oder spüren skurrilen Kosmetikwerbeinseraten in digitalisierten Zeitschriften der Jahrhundertwende nach.

Trainings für Schüler*innen im Center für Informations- und Medienkompetenz, ©ÖNB
4.1.2 ÖNB Spezial
ÖNB Spezial umfasst unter anderem das Angebot zur Recherche in Sonderbeständen, wie die Suche nach Nachlässen, Bildmaterialien oder Quellen zu Frauen- und genderspezifischen Themen, aber auch Schreibworkshops bis hin zum Training der Lesefertigkeit der deutsche Kurrent-Schrift – mit und ohne KI-Unterstützung. Ein besonderer Fokus liegt in dieser Programmkategorie auf dem Themenkomplex KI, wozu durch laufende Fortbildungsmaßnahmen Know-how seitens der Trainer*innen aufgebaut wurde. Mittlerweile drei Informationsexpert*innen beobachten neue Entwicklungen und zeichnen sich für die Konzeption der Trainings für unterschiedliche Wissensstände und Altersgruppen verantwortlich. Neben einer „Einführung in die Anwendung der KI“ sind derzeit (Sept. 2024) die Schulungen zu „KI-Tools in der Recherche“ und „Erkennen von KI-Fakes“ im Angebot des CIM.
4.1.3 ÖNB Wissensbissen
Die ÖNB Wissensbissen lösten das nicht mehr zeitgemäße Format „Einführung in Datenbanken“ ab. Konzipiert werden wechselnde, jeweils halbstündige Kurzvorstellungen von lizensierten Datenbanken zu den unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten. Um den Besuch der ÖNB Wissensbissen – jeweils einmal im Monat am frühen Abend – niederschwellig zu gestalten, ist keine Anmeldung erforderlich. Inhaltlich ist der Bogen weit gespannt von Volltextdatenbanken, über Zeitungsdatenbanken, biografische Datenbanken bis hin zu Datenbaken mit Quellen zur NS-Zeit. Der Ansatz dieser in Präsenz stattfindenden Kurztrainings war, jene Personen anzusprechen, die sich zum Zeitpunkt der Veranstaltung gerade im Haus aufhalten.
4.1.4 Modulsystem
Neu neben den Programmtrainings mit fixen Terminen wurde das Modulsystem für den universitären Bereich und Schulen konzipiert: rund 20 halbstündige bis einstündige vorgegebene Trainingseinheiten gegliedert in die drei Blöcke, „Recherche und Benützung“, „Nutzung von Datenbanken“, „Sonderbestände und Spezialthemen“ (in letzteren auch KI-Trainings enthalten), können bei freier Terminvereinbarung in beliebiger Länge kombiniert werden. Die gewählten Recherchebeispiele passen die Vortragenden dabei an das Thema der Lehrveranstaltung/des Lehrplans an. Die Trainingsinhalte entsprechen dabei im Wesentlichen den Inhalten der fixen Programmschulungen. Vorteil ist die individuelle Kombinationsmöglichkeit und die Anpassung an Vorlesungs-/Projekt-Themen.
4.2 Programm für Schulen
Neben dem flexiblen Modulprogramm für Schulen bietet das CIM inhaltlich fixierte Trainings für die Zielgruppe der Schüler*innen an.
4.2.1 Vorwissenschaftliche Arbeiten
In Österreich war bis zum Schuljahr 2023/24 in allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die Erstellung und Präsentation einer sogenannten „Vorwissenschaftlichen Arbeit“ (VWA) zu einem frei gewählten Thema verpflichtender Teil des Prüfungsumfangs zur Erlangung der Matura (Abitur). Diese „Vorwissenschaftliche Arbeit“ fußt auf Quellen- ebenso wie Literaturrecherche und wird von Lehrkräften betreut. Mit dem Schuljahr 2024/25 wurde diese Form der wissenschaftlichen Annäherung an ein Thema vor dem Hintergrund zunehmend elaborierter KI-Tools reformiert. Im Vordergrund stehen nun die Darstellung methodischer Überlegungen und Recherchewege. Zudem kann die abschließende Arbeit künftig auch das Produkt eines forschenden, gestalterischen oder künstlerischen Prozesses sein.[4]
Seit Einführung der VWAs im Jahr 2012 bietet die Österreichische Nationalbibliothek Recherchetrainings speziell für diese Abschlussarbeit für Schüler*innen im Klassenverband an. Inhalt der Trainings ist die Einführung in die Katalog- und Datenbank-Recherche sowie die gezielte Suche nach analogen und digitalen Medien. Diese Trainings waren von Beginn an hervorragend gebucht und wurden im Laufe der Jahre ständig an die Bedürfnisse der Schulen angepasst und erweitert. Die Reform der VWAs wird nach Einschätzung der Österreichischen Nationalbibliothek den Bedarf sogar noch steigern, da die Dokumentation und Reflexion des Entstehungsprozesses und der verwendeten Quellen nun im Vordergrund stehen. Diesem Ansatz folgend stehen im neuen Programm für Schulklassen nun verschiedene Angebote zur Auswahl: neben einem „VWA-Training kompakt“ mit der Dauer von 75 Minuten ein „VWA-Training Plus“ mit das Erlernte festigenden Übungseinheiten in 2,5 Stunden, eine „VWA-Sprechstunde“ in individuell vereinbarter Dauer für max. fünf Schüler*innen außerhalb des Klassenverbands und ein Training mit dem Titel „KI-Recherche für die VWA“. Letzteres hat neben einer Einführung in KI-Recherche-Tools den kritischen Blick auf erzielte Ergebnisse zum Inhalt.
Alle Trainings für Schulklassen umfassen ein Vorgespräch mit der Lehrkraft, um auf konkrete Fragestellungen mit Anwendungsbeispielen eingehen zu können. Auch die Anpassung der Übungseinheiten an ein frei gewähltes Thema wird angeboten.
Für Berufsschulen und polytechnische Schulen der 9. Schulstufe wurde zudem ein besonders praxisnahes Programm, individuell angepasst an die Fachrichtungen der Schulen, zur Vermittlung von Recherche-Know-how konzipiert.
Wie oben erwähnt, steht das Modulsystem mit gegenüber jenem für Erwachsene angepassten Inhalten auch für Schulklassen zur Verfügung. Auch hier ist die individuelle Kombination aus rund 20 30- bis 60-minütigen Einheiten aus drei Themenblöcken möglich.
4.2.2 Game Based Learning
Mystery-Hunts und Escape-Room-Spiele boomen seit Längerem, das war Grund genug für die Österreichische Nationalbibliothek als bislang erste Bibliothek Österreichs, in das Game Based Learning einzusteigen und Schüler*innen mit kniffligen Rechercheaufgaben an mehreren Stationen die Benützung der Bibliothek näherzubringen. Das Spiel mit dem Namen Abookalypse ist als Web-App mit Augmented-Reality-Elementen umgesetzt und wurde in Eigenentwicklung durch einen beauftragten Spielehersteller programmiert. Ziel ist der Abbau von Schwellenangst und das Kennenlernen der Bibliothek und ihrer Hilfsangebote für die bevorstehenden VWA.

Planspiel Abookalypse, ©ÖNB
Ein zweites Planspiel mit dem Titel Fake Hunter[5] ist ebenfalls an Schüler*innen adressiert. Ziel des Spiels ist ein bewusster und kritischer Umgang mit Fake News in Online-Medien und Social Media: Schüler*innen untersuchen als fiktive Mitarbeiter*innen einer Detektei ein zweifelhaftes News-Portal. Über eine eigens entwickelte Webseite, die mit Fake-News und echten News befüllt ist, lernen die Teilnehmer*innen herauszufinden, welche Artikel wahr und welche falsch sind und dies auch mit Prüfwerkzeugen zu belegen.
Da sich das Game Based Learning großer Beliebtheit erfreut, wird das Angebot um einen dritten Mystery-Hunt erweitert: Das Spiel mit dem Namen „Der dritte Band“ wird diesmal als analoge Escape-Rallye konzipiert und führt als „Taschenlampen-Tour“ durch den Bücherspeicher und die der Öffentlichkeit normalerweise verborgene Bereiche der Wiener Hofburg. Entlang einer mystischen Geschichte sind Rechercheraufgaben zu lösen, die den Weg zurück ans Tageslicht weisen.

Escape-Rallye „Der dritte Band“, ©ÖNB
Die „Abookalypse“ und das Spiel „Der dritte Band“ werden bei freier Terminvereinbarung auch für Gruppen von Erwachsenen angeboten.
Eine Warnung sei an dieser Stelle für potenzielle Nachahmer*innen ausgesprochen: Planspiele sind aufwändig, sowohl hinsichtlich der Gestaltung als auch der Durchführung. Im Fall von App-basierten Spielen kommen nicht unerhebliche Entwicklungskosten hinzu, weshalb hier auf eine nachhaltige, laufend erweiter- und adaptierbare Lösung zu setzen ist. Im Fall der Österreichischen Nationalbibliothek hat sich ein Web-App-basiertes Spiel als beste Lösung herausgestellt. Planspiele erfordern neben der Betreuung der Gruppen sowohl Vor- als auch Nachbereitungsarbeit und den Einsatz von mindestens zwei Mitarbeiter*innen während des Spiels.
4.2.3 Medienkollektionen
Als ergänzendes, ortsunabhängiges Angebot für Schulen verstehen sich die Medienkollektionen für den Unterricht, die sich derzeit in Vorbereitung befinden und ab 2025 zum kostenfreien Download zur Verfügung stehen werden. Es handelt sich dabei um pädagogisch aufbereitete Zusammenstellungen von analogen und digitalen Quellen zu einem konkreten Thema gemäß Lehrplan als Dossier für den Unterricht. Lehrkräften bieten diese Zusammenstellungen umfangreiche Inhalte mit Hintergrundwissen sowie konkreten Rechercheaufgaben für die Schüler*innen. Die ersten beiden Medienkollektionen der Österreichischen Nationalbibliothek sind den Themen „Historischer Antisemitismus in Österreich“ und „Geschichte der Medienentwicklung“ gewidmet. Bei diesem Vorhaben wird die Österreichische Nationalbibliothek hinsichtlich der didaktischen Aufbereitung von einer Pädagogischen Hochschule begleitet.
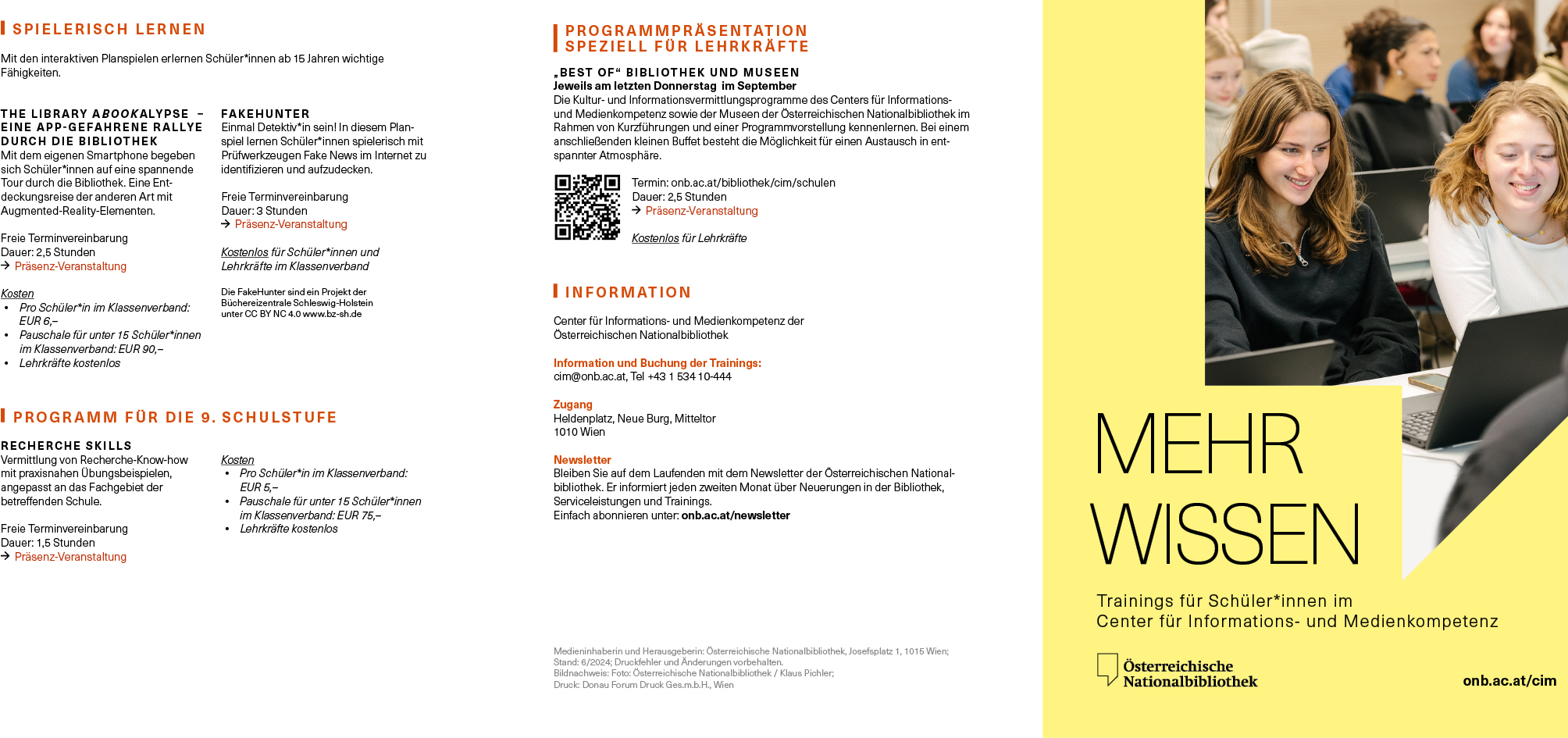
Programm des CIM für Schulklassen, ©ÖNB
4.3 Kooperationen
Mit dem Ziel der laufenden Aktualisierung und Praxisrelevanz hat die Österreichische Nationalbibliothek damit begonnen, Kooperationen mit Bildungspartnern aus dem universitären Bereich, der Erwachsenenbildung und Schulen einzugehen, um im regelmäßigen Austausch mit den Partnern das Angebot bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. Vorteile für Kooperationspartner*innen sind Rabatte, bevorzugte Zahlungskonditionen und Terminvergaben; die Österreichische Nationalbibliothek profitiert im Gegenzug vom Austausch mit den Adressat*innen der Programmangebote und der besseren Ressourcenplanung. Bislang wurden drei Kooperationen mit Schulen und Hochschulen eingegangen.
5 Do’s and Don’ts: Was sind die Lessons Learned?
5.1 Grundsätzliche Learnings
Als sehr gut kann die Buchungslage bei Schulen, universitären Einrichtungen und älteren Erwachsenen bezeichnet werden. Noch nicht gut gelungen ist die Ansprache der „raumnutzenden“ Leser*innen, die die Bibliothek vorrangig zum Lernen besuchen – in der Regel junge Studierende außerhalb von Lehrveranstaltungen. Die Buchungslage hat sich jedoch durch Promotion auf einer Studierenden-Plattform 2024 deutlich verbessert. Die App zur Plattform dient vorrangig der Organisation des Studienalltags für Studierende, umfasst aber weiterreichende zusätzliche Features wie einen Newsroom und Newsfeeds, in denen Angebote externer Partner*innen bekannt gemacht werden. Der Nachteil derartiger Plattformen ist der zumeist hohe Preis für gewerbliche Anbieter*innen, weshalb deren Einsatz vor allem in der Aufbauphase eines Teaching-Learning-Angebots zielführend erscheint.
Als weiterer Baustein zur gezielten Ansprache jüngerer Zielgruppen ist 2025 eine klassische Benutzerumfrage, begleitet durch eine Agentur, geplant, um diese Zielgruppe und deren Bedürfnisse besser kennenzulernen.
Die ursprünglich starke Strukturierung nach Zielgruppen, Kategorien und Programmgruppen im ersten Halbjahresprogramm des CIM ist nicht bis zu den Adressat*innen durchgedrungen und war sowohl online als auch im Print schwer übersichtlich darzustellen. Im Zuge einer Programmüberarbeitung wurde daher die bisherige Strukturierung nach Vorkenntnisstufen und Programmgruppen aufgegeben und durch eine tabellarische Darstellung des Gesamtangebots für alle Zielgruppen ersetzt.
Nicht gut angekommen sind – unerwartet – witzige Titel und Wortspiele wie „First come, first search“, „Auf gut Klick“ etc. Diese Titel haben daher im neuen Programm klarere Namen erhalten.
Nicht unerwartet hingegen war die auch personell zu berücksichtigende Notwendigkeit, das Programm laufend zu evaluieren und zumindest halbjährlich neuen Trends und technischen Weiterentwicklungen anzupassen. So sind schon in der kurzen Zeit seit Eröffnung des CIMs im Herbst 2022 sämtliche Titel zu den Themenkomplexen Fake News und Fake Science zu Gunsten von KI-Themen aus dem Programm genommen worden. Von der Streichung betroffen waren dabei auch sehr aufwändig gestaltete Formate wie „Faken und Fiktionen“, in denen anhand historischer Fernsehserien belegte Ereignisse versus dichterischer Freiheit nachgespürt wurde.
Gut bewährt hat sich das Modul-Programm für Studierende, insbesondere mit dem Angebot, die Trainingseinheiten an Vorlesungsthemen anzupassen.
Dauerbrenner im Programm sind seit vielen Jahren Trainings zur Ahnenforschung, die meist ein älteres Publikum anziehen sowie Trainings zum Erlernen der Lesefähigkeit der deutschen Kurrentschrift – mittlerweile auch mit einem KI-Ableger zur elektronischen Texterkennung der deutschen Kurrentschrift. Bei den Trainings zur Kurrentschrift hat sich das Publikum sehr stark Richtung Studierende der Geisteswissenschaften hin entwickelt, was einen Mangel an derartigen Trainings in den umliegenden Bildungseinrichtungen aufzeigt.
Im Bereich der Schulen wurden die aufbauenden, aber auch einzeln buchbaren Trainings der Schiene „Digital Literacy“ kaum gebucht. Diese Schiene umfasste vier Trainings von der „Katalogrecherche“ über „Literaturverwaltungsprogramme“, „Seriöse Quellen im Internet“ bis hin zur „Recherche in der Digitalen Bibliothek“. Die Umgestaltung und Erweiterung in halb- bzw. einstündige Einheiten im Rahmen des erwähnten Modulprogramms hat sich hier als zielführend erwiesen.
Im Eröffnungsprogramm des CIMs noch enthalten war auch ein Angebot für einzelne Schüler*innen, deren Lehrkräfte kein VWA-Training im Klassenverband buchten: die VWA-Summer- bzw. Winter-School zu fixen Terminen in den Semester- bzw. Sommerferien. Das Angebot wurde seitens der Schüler*innen nicht angenommen und daher gestrichen.
5.2 Thema kostenlos versus kostenpflichtig
Die Trainingsangebote des CIM richten sich an ein breites Publikum, an Studierende ebenso wie ältere Erwachsene und Schüler*innen. Der Besitz einer Tages- oder Jahreskarte der Österreichischen Nationalbibliothek ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Ein Teil der Trainings ist kostenpflichtig, wenn auch niederpreisig (€ 5,-/Studierende bis € 6,-/Erwachsene pro 75-Minuten-Einheit).
Während für physische Museumseintritte und Bibliothekseintritte vor und nach der Pandemie selbstverständlich bezahlt wurde und wird, ist die Erwartungshaltung für die Kultur- und Informationsvermittlung speziell im digitalen Raum, dass sie kostenlos ist.
Die meisten Bibliotheken und Museen in Österreich folgten während der Pandemie dem ungeschriebenen Gesetz der gratis Online-Angebote. Damit entstand auch eine Erwartungshaltung beim Publikum: Im Internet ist Kultur kostenlos. Dies gilt auch für Webinare zu Informationsvermittlungsthemen.
Seit Ende der Pandemie verschiebt sich die Buchungslage trotz Wahlfreiheit zwischen online und Präsenz stark hin zur Präsenzteilnahme, wo auch die Kosten eher in Kauf genommen werden. Reine Webinare werden kaum nachgefragt, dies hat auch mit der Zielsetzung der Lehrenden, Schwellenängste abzubauen und die Institution Österreichische Nationalbibliothek als Rechercheeinrichtung für Schule und Studium vorzustellen, zu tun.
Als neues Angebot bietet das CIM dennoch Einsteigerschulungen für Schüler*innen und Erwachsene hybrid und kostenfrei an, um auch Teilnehmer*innen aus den Bundesländern und dem Ausland anzusprechen.
Umgesetzt wurde 2024 zudem ein Bonus-Pass-System, bei dem die sechste Teilnahme gratis ist.
6 Marketing
Seit der Eröffnung des CIM wurden mit dem Ziel der Ansprache vor allem jüngerer Lesergruppen vielfältige Marketingmaßnahmen ergriffen, die sukzessive weiter ausgebaut werden. Für das Marketing zeichnet die Abteilung für Kommunikation und Marketing der Österreichischen Nationalbibliothek verantwortlich, die Marketingeinsätze mit der Abteilung Kundenservices, Leserberatung und Schulungsmanagement abstimmt.
6.1 Klassisches Marketing
Druck von Foldern: derzeit erscheinen jährlich fünf Folder, zwei zum Halbjahresprogramm für Erwachsene, ein Folder zum Schulprogramm, und je ein Folder zum Modulprogramm für Universitäten und Schulen. Diese Folder werden zielgruppenspezifisch an bestehende Kontakte wie Journalist*innen, Freundeskreis, Stakeholder, Teilnehmer*innen an Veranstaltungen der Österreichischen Nationalbibliothek, an alle Schulen mit Oberstufenklassen in Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie an die Vorstände und Studienprogrammleiter*innen vieler Universitätsinstitute aus dem Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften versandt und zusätzlich beim Kauf einer Tages- oder Jahreskarte ausgegeben.
Vor den Lesesälen werden Roll-Ups mit dem Jahresprogramm platziert.
Infoscreens im Benützungsbereich werden mit Programmhighlights bespielt. Wichtig dabei sind bildlastige, wöchentlich wechselnde Inhalte mit Eyecatchern. Programmübersichten sind für diese Präsentationsflächen ungeeignet.
Zusätzlich werden fallweise „Guerilla-Marketing“-Aktivitäten gesetzt. Zum Beispiel aufmerksamkeitsstarke Aussagen im Stil anderer Informationsmittel, bewusst nicht im Corporate Design und an ungewöhnlichen Orten affichiert.
6.2 Soziale Medien
Die Österreichische Nationalbibliothek ist derzeit auf Facebook und Instagram vertreten. Diese Kanäle werden regelmäßig bespielt und auch für das Marketing des CIM genutzt. Neben dem klassischen Posting zu Trainingsformaten wird die Community auf Instagram mit Quizzens zu Bibliotheksthemen unterhalten. Gut angenommen werden Insta-Reels mit Impressionen oder kuriosen Fragestellungen zu den Inhalten bereits stattgefundener Trainings. Regelmäßig veranstaltete Insta-Walks mit der Insta-Community der Österreichischen Nationalbibliothek dienen der Vorstellung des CIM generell oder neuer Programminhalte.
In naher Zukunft geplant sind sogenannte Call-to-Action-Elemente mit Bezug zum digitalen Medienbestand der Österreichischen Nationalbibliothek, z. B. #tinderannodazumal (poste die schrägste historische Heiratsannonce) etc.
Im weiteren Sinne der Bekanntmachung des CIM ist auch der dem Content-Marketing gewidmete hauseigene Bibliotheksblog gewidmet. In monatlich erscheinenden Beiträgen zu jubiläumsaktuellen oder jahreszeitlich passenden Themen werden nicht nur die vielfältigen Bestände des Hauses auf niederschwelliger Ebene bekannt gemacht, sondern auch zum Thema passende Trainings beworben.
6.3 Redaktionelle und bezahlte Print- und Online-Medien
Stories zu ausgewählten Trainings werden als Medienpartnerschaft gemeinsam mit Journalist*innen, und Blogger*innen aus dem Kulturbereich gestaltet. Ausgewählte Trainings des CIM werden auf der größten österreichischen Studierenden-Plattform werblich präsentiert.
6.4 Wettbewerbe und Rahmenveranstaltungen
Mit dem Ziel der Bekanntmachung von innovativen Formaten wie zum Beispiel dem Game Based Learning nimmt die Österreichische Nationalbibliothek auch an Innovationswettbewerben teil.
Eine wichtige Präsentationsfläche für das Programm des CIM sind große Rahmenveranstaltungen wie etwa „Safer Internet“ oder „Österreich liest“, bei dem mit Schwerpunksetzungen unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden können.
Programm-Highlights werden in einer Kurzversion auch bei hauseigenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der zweimal jährlich stattfindenden „Late Week“ zu den Prüfungswochen oder eines „Open House“, kostenfrei angeboten.
6.5 Ansprache von Pädagogik-Multiplikator*innen
Lehrpersonal und Schulbibliothekar*innen werden unter anderem in Form einer jährlich stattfindenden Programmpräsentation im Setting einer Mini-Messe mit anschließendem Get-together und kostenfreien Probetrainings persönlich angesprochen. Bereits etabliert ist auch der Pädagog*innen-Newsletter, der in regelmäßigen Abständen über alle Angebote der Österreichischen Nationalbibliothek für Schulen informiert.
Zudem wird das Angebot des CIM auf allen relevanten Online-Plattformen aus dem schulischen Umfeld regelmäßig redaktionell positioniert.
7 Resümee
Ein Resümee über die vielfältigen Aktivitäten der Österreichischen Nationalbibliothek zum Aufbau einer in der Organisation verankerten Teaching Library scheint angesichts der kurzen Zeitspanne von knapp zwei Jahren seit Eröffnung des CIM verfrüht, ein erstes Fazit ist jedoch möglich: Die Vermittlung von Informationskompetenz wird angesichts der rasanten technologischen Entwicklung wichtiger denn je, denn Bibliotheken sind Orte, von denen zu Recht Expertise im quellenkritischen Umgang mit Medien erwartet werden darf. Die Institutionalisierung eines entsprechenden Vermittlungsprogramms ist nicht nur eine lohnende, sondern eine gesellschaftspolitisch erforderliche Aufgabe, die Bibliotheken übernehmen können. Dabei sollte allen beteiligten Playern aber bewusst sein, dass die Programmgestaltung stets am Puls der Zeit sein muss und damit ein „work in progress“ bleibt. Eine entsprechende personelle und budgetäre Abdeckung inklusive professionellem Marketing kann das Vermittlungsangebot von Bibliotheken von einem Nischenprogramm zu einem anerkannten und wahrgenommenen Bildungspartner aufsteigen lassen.
Über den Autor / die Autorin

Margot Werner
Literaturverzeichnis
Österreichischen Nationalbibliothek (Hrsg.) (2021): Vision 2035. Wir öffnen Räume. Wien: Österreichischen Nationalbibliothek.Suche in Google Scholar
© 2025 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
Artikel in diesem Heft
- Titelseiten
- Editorial
- Teaching Library und die Vermittlung von Informationskompetenz
- Theoretische Konzepte der Teaching Library
- 30 Jahre Teaching Library (D-A-CH): Von der Katalogschulung zum Lernort Bibliothek?
- Das Framework for Information Literacy for Higher Education der ACRL: Sein Potenzial für die Vermittlung von Informationskompetenz und seine Auswirkungen auf die Vermittlungspraxis der Teaching Librarians im deutschen Sprachraum
- Und ja, IK soll auch Spaß machen: Meine Kurse sind keine Vorlesungen, sondern Infotainment
- Von Forschenden oft unterschätzt: Erfolgreicher forschen mit Informationskompetenz
- Good Practices
- Medienbildung in Öffentlichen Bibliotheken
- Desinformation auf der Spur: Konzept einer Bibliotheksschulung
- Praxisbericht: Das Konzept des neuen Centers für Informations- und Medienkompetenz der Österreichischen Nationalbibliothek
- Demokratiepädagogisch Agieren in (Öffentlichen) Bibliotheken
- PISA, IGLU, IQB & Co – Einsatz von aktuellen Studien und Untersuchungen in der bildungspolitischen Arbeit von Bibliotheken
- Gestaltung von E-Learning-Angeboten in Bibliotheken zur Förderung der Medien- und Informationskompetenz
- Vision und Realität: Liaison Librarians und Informationskompetenz an der Universitäts- und Zentralbibliothek Zürich
- KI in der Informationskompetenz
- Künstliche Intelligenz in der Literaturrecherche
- Forschungsperspektiven zu KI, Informationsverhalten und Informationskompetenz
- Professionalisierung durch Kollaboration: OER im Verbund
- Didaktische Ansätze und Ausbildung
- Erstellung eines Moodle-Selbstlernkurses zur Recherche- und Informationskompetenz an der Universitätsbibliothek Wien: ein Werkstattbericht
- Das Bibliothekspraktikum „Studierende beraten Studierende“
- Der neue Zertifikatskurs „Teaching Librarian“ am Postgraduate Center der Universität Wien
- Zukunftsgestalter
- Multimediale Lernangebote und physischer Lernraum zur Förderung von Informations- und Medienkompetenz in den Geowissenschaften – hybrid, kreativ, nachhaltig
- Weitere Beiträge
- Weiterbildung in wissenschaftlichen Bibliotheken: Status quo und Perspektiven
- Stand und Perspektive von ORCID in Deutschland
- Agiles Service Engineering für digitale forschungsunterstützende Dienste in Hochschulbibliotheken
- Rezensionen
- Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland (Hrsg.): Handreichung zu Bau und Ausstattung Öffentlicher Bibliotheken, 2024. 105 S., aktual. und erw. Fassung. Zum Download verfügbar unter https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/strategie-und-planung/planungsgrundlagen/
- Barbian, Jan-Pieter: Literaturpolitik im NS-Staat. Von der „Gleichschaltung“ bis zum Ruin. Überarbeitete und aktualisierte Neuausgabe. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2024. 511 S., ISBN 978-3-10-397583-3. Hardcover € 36,-
- Die Bibliothek für alle. Der Büchereientwicklungsplan des Bundes. Wien: Büchereiverband Österreichs, 2024 (= Büchereiperspektiven Sonderausgabe 2024). 56 S., ISSN 1607-7172
- Am Anfang waren die Bücher. 250 Jahre bibliotheca publica. 25 Jahre Oö. Landesbibliothek. Hrsg. von der Oberösterreichischen Landesbibliothek und dem Oberösterreichischen Landesarchiv. Redaktion: Renate Plöchl, Julian Sagmeister, Martin Vejvar. Linz: Oö.Landesarchiv, 2024. 192 S., 223 Abb. ISBN 978-3-902801-51-7. Hardcover, € 28,60
- Call for Papers
- Call for Papers
Artikel in diesem Heft
- Titelseiten
- Editorial
- Teaching Library und die Vermittlung von Informationskompetenz
- Theoretische Konzepte der Teaching Library
- 30 Jahre Teaching Library (D-A-CH): Von der Katalogschulung zum Lernort Bibliothek?
- Das Framework for Information Literacy for Higher Education der ACRL: Sein Potenzial für die Vermittlung von Informationskompetenz und seine Auswirkungen auf die Vermittlungspraxis der Teaching Librarians im deutschen Sprachraum
- Und ja, IK soll auch Spaß machen: Meine Kurse sind keine Vorlesungen, sondern Infotainment
- Von Forschenden oft unterschätzt: Erfolgreicher forschen mit Informationskompetenz
- Good Practices
- Medienbildung in Öffentlichen Bibliotheken
- Desinformation auf der Spur: Konzept einer Bibliotheksschulung
- Praxisbericht: Das Konzept des neuen Centers für Informations- und Medienkompetenz der Österreichischen Nationalbibliothek
- Demokratiepädagogisch Agieren in (Öffentlichen) Bibliotheken
- PISA, IGLU, IQB & Co – Einsatz von aktuellen Studien und Untersuchungen in der bildungspolitischen Arbeit von Bibliotheken
- Gestaltung von E-Learning-Angeboten in Bibliotheken zur Förderung der Medien- und Informationskompetenz
- Vision und Realität: Liaison Librarians und Informationskompetenz an der Universitäts- und Zentralbibliothek Zürich
- KI in der Informationskompetenz
- Künstliche Intelligenz in der Literaturrecherche
- Forschungsperspektiven zu KI, Informationsverhalten und Informationskompetenz
- Professionalisierung durch Kollaboration: OER im Verbund
- Didaktische Ansätze und Ausbildung
- Erstellung eines Moodle-Selbstlernkurses zur Recherche- und Informationskompetenz an der Universitätsbibliothek Wien: ein Werkstattbericht
- Das Bibliothekspraktikum „Studierende beraten Studierende“
- Der neue Zertifikatskurs „Teaching Librarian“ am Postgraduate Center der Universität Wien
- Zukunftsgestalter
- Multimediale Lernangebote und physischer Lernraum zur Förderung von Informations- und Medienkompetenz in den Geowissenschaften – hybrid, kreativ, nachhaltig
- Weitere Beiträge
- Weiterbildung in wissenschaftlichen Bibliotheken: Status quo und Perspektiven
- Stand und Perspektive von ORCID in Deutschland
- Agiles Service Engineering für digitale forschungsunterstützende Dienste in Hochschulbibliotheken
- Rezensionen
- Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland (Hrsg.): Handreichung zu Bau und Ausstattung Öffentlicher Bibliotheken, 2024. 105 S., aktual. und erw. Fassung. Zum Download verfügbar unter https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/strategie-und-planung/planungsgrundlagen/
- Barbian, Jan-Pieter: Literaturpolitik im NS-Staat. Von der „Gleichschaltung“ bis zum Ruin. Überarbeitete und aktualisierte Neuausgabe. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2024. 511 S., ISBN 978-3-10-397583-3. Hardcover € 36,-
- Die Bibliothek für alle. Der Büchereientwicklungsplan des Bundes. Wien: Büchereiverband Österreichs, 2024 (= Büchereiperspektiven Sonderausgabe 2024). 56 S., ISSN 1607-7172
- Am Anfang waren die Bücher. 250 Jahre bibliotheca publica. 25 Jahre Oö. Landesbibliothek. Hrsg. von der Oberösterreichischen Landesbibliothek und dem Oberösterreichischen Landesarchiv. Redaktion: Renate Plöchl, Julian Sagmeister, Martin Vejvar. Linz: Oö.Landesarchiv, 2024. 192 S., 223 Abb. ISBN 978-3-902801-51-7. Hardcover, € 28,60
- Call for Papers
- Call for Papers

