Reviewed Publication:
Urban Thomas Verstellter Blick. Die Deutsche Ostpolitik. 2. Auflage Berlin edition.fotoTAPETA_Flugschrift 2022 1 191
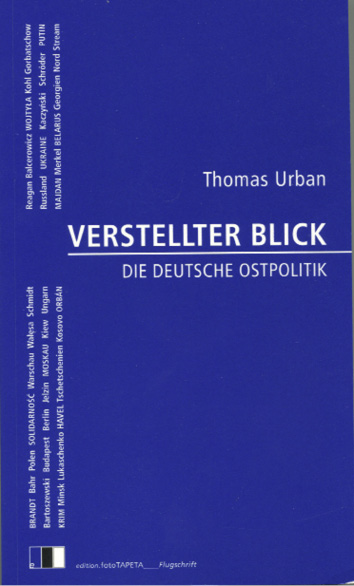
Ohne den von Russland entfesselten Krieg gegen die Ukraine würde die deutsche Osteuropa-Politik wohl weiter im Windschatten anderer Großereignisse und Schauplätze stehen und nur für wenige Experten und Journalisten relevant sein. Doch der Krieg änderte alles. Zwar wurde die deutsche Russlandpolitik von Schröder bis Merkel seit langem kritisiert, Sonderprojekte wie Nord Stream 1 und 2 von unseren östlichen Nachbarn rundweg abgelehnt und der Glaube Berlins an Verhandlungslösungen mit Moskau weithin als naiv angesehen. Doch davon ließ man sich hierzulande in weiten Teilen von Politik und Wirtschaft nicht beeindrucken, schon gar nicht beeinflussen. Die bundesdeutschen Russland-Koordinaten standen bis zum 23. Februar 2022 auf Verhandeln, Beschwichtigen und moderatem Bestrafen. Nun, da der Krieg ins zweite Jahr geht und einige neue Publikationen zur deutschen (Teil-)Verantwortung oder gar Schuld an dieser Situation erschienen sind, heißt es, die Puzzlestücke nüchtern zusammenzusetzen, um ein besseres Bild der deutschen Ostpolitik der letzten zwei Jahrzehnte zu erhalten. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan, denn der Krieg lässt zahlreiche Entwicklungen und Entscheidungen Deutschlands aus der jüngeren Vergangenheit in einem (noch) schlechteren Licht erscheinen. Für das deutsche Publikum zentral: Ostpolitik heißt nicht allein Berlin, Moskau und der Rest, obwohl nicht wenige das bis heute so sehen. Die Vektoren auswärtigen Handelns sind vielfältiger und in jeder ost(mittel)europäischen Hauptstadt ist die Wahrnehmung von Deutschland eine andere. Und über allem hängt der schwere Schatten der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Der Journalist und Autor Thomas Urban war viele Jahre Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und kennt die Region. In seinem kurz vor dem Ukraine-Krieg erschienenen Buch Verstellter Blick. Die Deutsche Ostpolitik zeigt er auf, „welchen Anteil die Politik Berlins an den unguten Entwicklungen im Osten Europas hatte, in Warschau, in Kiew und in Moskau. Oft handelt es sich dabei nicht um Entscheidungen der operativen Politik, sondern um Missverständnisse, um fehlende Klarstellungen. Oder sogar um unangemessene Gesten, um das Ignorieren nationaler Empfindlichkeiten“ (S. 11). Man ist also vorgewarnt, dass schon kleine Verletzungen zu bleibenden Missstimmungen oder Schäden führen können. Was beim Lesen gleich zu Beginn erstaunt, ist die Ähnlichkeit der Argumente, die damals gegenüber der Sowjetunion vorgebracht wurden und die auch heute noch gegenüber Russland ins Feld geführt werden. Vor allem die Russland-Verklärung der SPD ist keine Besonderheit seit Gerhard Schröder, sondern gehört quasi zur DNA der Partei seit Willy Brandt – also seit über einem halben Jahrhundert. Die Verständnis- und Beschwichtigungsargumente von Willy Brandt, Egon Bahr und Rudolf Augstein erleben gegenwärtig eine Neuauflage durch Sahra Wagenknecht, Alice Schwarzer, Erich Vad und andere. Besonders die Polen haben den Sozialdemokraten nie verziehen, dass führende Parteileute wie Egon Bahr die Solidarność-Bewegung als Gefahr für den Frieden und die Stabilität im Ostblock ansahen und damit Moskaus Vorherrschaft in Ost(mittel)europa legitimierten und verteidigten.
Gleichgewicht und Stabilität waren den West-Genossen wichtiger als Freiheit und Selbstbestimmung. „Nach der Wende von 1989/90 schlug SPD-Politikern an der Weichsel großes Misstrauen entgegen; es bekam später weitere Nahrung durch die Annäherung zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin“ (S. 22). Doch nicht allein die westdeutsche Sozialdemokratie und die Friedensbewegung waren beseelt von der Notwendigkeit des Entgegenkommens gegenüber Moskau. Es war ein weitverbreitetes Phänomen, dass auch im wiedervereinigten Deutschland zahlreiche Anhänger leitet: „Weite Kreise der westdeutschen Gesellschaft hingen […] einem naiven Irrglauben an, wenn sie die Parole ausgäben, dass die Friedfertigen nicht angegriffen würden. Die Geschichte kenne kein Beispiel dafür, aber unzählige für das Gegenteil“ (S. 24). Dabei zeigt Urban, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen der Zeit des Kalten Krieges und der Gegenwart. Die alten Argumente der Entspannungspolitik taugen für die heutige Konfliktlage schlicht nicht mehr: „Breschnew wollte gewaltsam gezogene Grenzen durch internationale Abkommen bestätigt sehen; Putin möchte durch internationale Abkommen bestätigte Grenzen gewaltsam ändern“ (S. 17). Dieser gewaltsame Revisionismus von Putin scheint nicht erkannt zu werden oder als normales Verhalten in den internationalen Beziehungen zu gelten. Dass dies keineswegs nur ein Problem fehlender politischer und historischer Allgemeinbildung ist, sondern auch von Leuten an der Spitze falsch gesehen wurde, zeigt Urban am ehemaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. „Deutsche Diplomaten klagten in Hintergrundgesprächen, dass Steinmeier die Konstante der russischen Außenpolitik seit den Zeiten der Zaren nicht verstanden habe: Verhandelt wird nur aus einer Position der Stärke, Kompromisse werden vermieden; stattdessen werden Konflikte angeheizt, wenn eine für den Kreml vorteilhafte Lösung nicht kurzfristig durchzusetzen ist“ (S. 53). Sein Konzept der „Annäherung durch Verflechtung“ mag von guten Absichten geleitet gewesen zu sein. Im Rückblick erscheint es jedoch eher als eine „Annäherung durch Übernahme“ – seitens Russlands.
In Warschau begegnete man Steinmeiers Kurs daher von Anfang an mit „größter Skepsis“ (S. 91). Erst heute wird langsam klar, welche Auswirkungen die deutsche Russland- und Energiepolitik auf andere Politikfelder hatte, allen voran die Klimapolitik. „Da die Polen Steinmeier für naiv hielten und russischen Zusagen nicht trauten, bauten sie die Kohleförderung aus, Kohlekraftwerke decken drei Viertel ihres Energiebedarfs. Bei Ostwind wehen die Emissionen nach Deutschland. Auch die Ukraine erhöhte ihre Kohleförderung in den Jahren vor dem Krieg um den Donbass beträchtlich und modernisierte ihre Atomkraftwerke“ (S. 128). Deutschlands Energiesonderbeziehungen nach Russland vertieften somit nicht nur das Misstrauen gegenüber Berlin und schwächten die europäische Energiegemeinschaft, sondern torpedierten auch die Klimabemühungen und trugen zur Verfestigung der fossilen Energiestrukturen in den Nachbarländern bei.
Neben den großen Problemfeldern sind es die Ausführungen des Autors zur Wahrnehmung Deutschlands in Polen, der Ukraine und im Baltikum, die die Lektüre so wertvoll machen. Einige Anekdoten amüsieren und beschämen zugleich, etwa, wenn über die fehlenden Sprachkenntnisse deutscher Diplomaten in Polen berichtet wird. „Wie wenig die deutschen Geschäftsträger an der Weichsel in dieser Zeit der Spannungen die Stimmungen in ihrem Gastland einzuschätzen wussten, zeigte sich während des Konklaves nach dem Tod von Johannes Paul II. im April 2005. Da ja ein Deutscher als Favorit des Kardinalkollegiums galt, versammelten sich polnische Fernsehteams vor der Botschaft. Doch als dieser tatsächlich bereits am ersten Abend des Konklaves gewählt wurde und als Benedikt XVI. auf den Balkon über dem Petersplatz getreten war, ging nicht der deutsche Botschafter zu den polnischen Journalisten, um ein paar Sätze über die langjährige enge Freundschaft zwischen Joseph Ratzinger und Johannes Paul II. zu sagen, sondern ein Wachmann beschied den Wartenden über die Sprechanlage in schlechtem Englisch, dass bereits Dienstschluss sei. Die Fernsehnachrichten zeigten diese befremdliche Szene, die auch in anderen Medien kritisch kommentiert wurde“ (S. 90). Was will man dazu noch sagen? Der deutsche (Beamten-)Michel, wie er leibt und lebt. Zu hoffen bleibt, dass künftige Diplomaten und Politiker nicht nur die notwendigen Sprach- und Landeskenntnisse mitbringen, sondern das Feingefühl besitzen, die Sichtweisen der Gastländer richtig zu verstehen. Thomas Urbans Buch leistet hierfür einen wertvollen Beitrag. Es zeigt den selbstverschuldet verstellten Blick der Bundesrepublik auf den Osten Europas. Glücklicherweise sind Blickrichtungen veränderbar. Ein solitärer Tunnelblick Berlins nach Moskau sollte künftig vermieden werden; besser ein geopolitischer Rundumblick.
About the author
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand der Politikwissenschaft
© 2023 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Energiesicherheit unter Bedingungen der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Verkehr
- Eine EU-Rohstoffagentur – Sinnvolles Instrument für die europäische Rohstoffsicherheit?
- Toxische Türöffner – Smart Ports als geoökonomisches Handlungsfeld
- Der Schutz maritimer kritischer Infrastrukturen und das Konzept der Abschreckung
- Kurzanalysen
- Unruhefaktor Iran – Welche Kriegsrisiken bestehen im Nahen Osten?
- Der Disput über das Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea – Wie Seoul seine nationalen Interessen im Kontext des sino-amerikanischen strategischen Wettbewerbs verfolgte
- Kommentar
- Den Weltkrieg vermeiden – aber welchen?
- Ergebnisse internationaler strategischer Studien
- Kritische Infrastruktur
- Ferdinand Alexander Gehringer: Unterseekabel als Kritische Infrastruktur und geopolitisches Machtinstrument. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, Dezember 2022
- Ukraine-Krieg
- Seth G. Jones/Riley McCabe/Alexander Palmer: Ukrainian Innovation in a War of Attrition. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Februar 2023
- Seth G. Jones: Empty Bins in a Wartime Environment. The Challenge to the U.S. Defense Industrial Base. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Januar 2023
- Bryan Frederick/Samuel Charap/Karl P. Mueller: Responding to a Limited Russian Attack on NATO during the Ukraine War, a perspective. Santa Monica, Cal.: The RAND Corporation, Dezember 2022
- Samuel Charap/Miranda Priebe: Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict. Santa Monica, Cal.: The RAND Corporation, Januar 2023
- Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland
- Gerard DiPippo/Andrea Leonard Palazzi: Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia’s Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Februar 2023
- Maria Snegovaya/Tina Dolbaia/Nick Fenton/Max Bergmann: Russia Sanctions at One Year. Learning from the Cases of South Africa and Iran. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Februar 2023
- Andrew David/Sarah Stewart/Meagan Reid/Dmitri Alperovitch: Russia Shifting Import Sources Amid U.S. and Allied Export Restrictions. Washington, D.C.: Silverado Policy Accelerator, Januar 2023
- Buchbesprechungen
- Michael Thumann: Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. München: C.H.Beck 2023, 288 Seiten
- Thomas Urban: Verstellter Blick. Die Deutsche Ostpolitik. 2. Auflage. Berlin: edition.fotoTAPETA_Flugschrift 2022, 191 Seiten.
- Gerhard Conrad/Martin Specht: Keine Lizenz zum Töten. 30 Jahre als BND-Mann und Geheimdiplomat. Berlin: Econ/Ullstein Buchverlage 2022, 320 Seiten
- Arye Sharuz Shalicar: Schalom Habibi. Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Leipzig: Hentrich & Hentrich 2022, 162 Seiten
- Michael Paul: Der Kampf um den Nordpol. Die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte, Freiburg: Herder 2022, 286 Seiten
- Bücher von gestern – heute gelesen
- Hans L. Trefousse: Germany and American Neutrality, 1939–1941. New York: Octagon Books 1969, 247 Seiten
- Bildnachweise
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Energiesicherheit unter Bedingungen der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Verkehr
- Eine EU-Rohstoffagentur – Sinnvolles Instrument für die europäische Rohstoffsicherheit?
- Toxische Türöffner – Smart Ports als geoökonomisches Handlungsfeld
- Der Schutz maritimer kritischer Infrastrukturen und das Konzept der Abschreckung
- Kurzanalysen
- Unruhefaktor Iran – Welche Kriegsrisiken bestehen im Nahen Osten?
- Der Disput über das Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea – Wie Seoul seine nationalen Interessen im Kontext des sino-amerikanischen strategischen Wettbewerbs verfolgte
- Kommentar
- Den Weltkrieg vermeiden – aber welchen?
- Ergebnisse internationaler strategischer Studien
- Kritische Infrastruktur
- Ferdinand Alexander Gehringer: Unterseekabel als Kritische Infrastruktur und geopolitisches Machtinstrument. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, Dezember 2022
- Ukraine-Krieg
- Seth G. Jones/Riley McCabe/Alexander Palmer: Ukrainian Innovation in a War of Attrition. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Februar 2023
- Seth G. Jones: Empty Bins in a Wartime Environment. The Challenge to the U.S. Defense Industrial Base. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Januar 2023
- Bryan Frederick/Samuel Charap/Karl P. Mueller: Responding to a Limited Russian Attack on NATO during the Ukraine War, a perspective. Santa Monica, Cal.: The RAND Corporation, Dezember 2022
- Samuel Charap/Miranda Priebe: Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict. Santa Monica, Cal.: The RAND Corporation, Januar 2023
- Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland
- Gerard DiPippo/Andrea Leonard Palazzi: Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia’s Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Februar 2023
- Maria Snegovaya/Tina Dolbaia/Nick Fenton/Max Bergmann: Russia Sanctions at One Year. Learning from the Cases of South Africa and Iran. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Februar 2023
- Andrew David/Sarah Stewart/Meagan Reid/Dmitri Alperovitch: Russia Shifting Import Sources Amid U.S. and Allied Export Restrictions. Washington, D.C.: Silverado Policy Accelerator, Januar 2023
- Buchbesprechungen
- Michael Thumann: Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. München: C.H.Beck 2023, 288 Seiten
- Thomas Urban: Verstellter Blick. Die Deutsche Ostpolitik. 2. Auflage. Berlin: edition.fotoTAPETA_Flugschrift 2022, 191 Seiten.
- Gerhard Conrad/Martin Specht: Keine Lizenz zum Töten. 30 Jahre als BND-Mann und Geheimdiplomat. Berlin: Econ/Ullstein Buchverlage 2022, 320 Seiten
- Arye Sharuz Shalicar: Schalom Habibi. Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Leipzig: Hentrich & Hentrich 2022, 162 Seiten
- Michael Paul: Der Kampf um den Nordpol. Die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte, Freiburg: Herder 2022, 286 Seiten
- Bücher von gestern – heute gelesen
- Hans L. Trefousse: Germany and American Neutrality, 1939–1941. New York: Octagon Books 1969, 247 Seiten
- Bildnachweise


