Reviewed Publication:
Shambaugh David China and the World New York Oxford University Press 2020 1 394
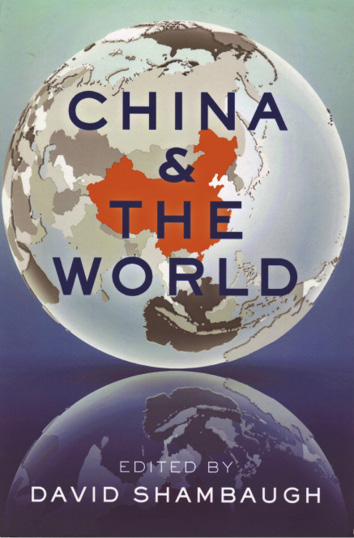
Der Bedarf an Wissen über China wächst. David Shambaugh, einer der profiliertesten westlichen Sino-Politologen, möchte mit dem von ihm herausgegebenen Lehrbuch eine Lücke in der Literatur schließen. China and the World gibt in 16 Kapiteln eine Übersicht über Chinas Außenbeziehungen und ihre weltpolitischen Dimensionen. Zielgruppe sind Studienanfänger wie Fachleute. Das Buch soll, der Dynamik seines Gegenstands folgend, künftig alle fünf bis zehn Jahre neu erscheinen.
Zu Beginn rekapituliert Shambaugh das Verhältnis der Volksrepublik zur übrigen Welt seit 1949. Nach zwei Jahrzehnten diplomatischer Isolation und innerer Erschütterungen gewann China in den 1970er Jahren Anschluss an die westlichen Staaten. Das chinesisch-amerikanische Verhältnis wandelte sich von einer seit dem Koreakrieg (1950–53) erbitterten Feindschaft ab 1971 hin zu einer strategischen Verbindung gegen die Sowjetunion. Die nach dem Tod Mao Zedongs durch Deng Xiaoping eingeleiteten Reformen bewirkten seit den 1980er Jahren einen rasanten wirtschaftlichen und sozialen Wandel in China. Der Untergang der UdSSR und der weltpolitische Umbruch um 1990 bedeuteten einerseits das Ende der geostrategischen Kooperation zwischen China und den USA, andererseits einen enormen Bedeutungsgewinn der sich rasch globalisierenden chinesischen Wirtschaft. In den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts erreichten Chinas Handelsvolumen und seine ausländischen Direktinvestitionen schwindelerregende Höhen. Sowohl der eigene ökonomische Erfolg als auch die unübersehbaren Probleme Amerikas stärkten das Selbstvertrauen der chinesischen Führung. Unter dem seit 2012 amtierenden Staats- und Parteichef Xi Jinping nimmt die Außenpolitik einen deutlich höheren Stellenwert ein als bei seinen Vorgängern Jiang Zemin und Hu Jintao. Heute präsentiert sich das Reich der Mitte als Weltmacht, die zu alter Größe zurückkehrt.
In Kapitel 2 beleuchtet der in Yale lehrende Historiker Arne Westad das von der Volksrepublik weitergetragene Erbe der Vergangenheit. Die für die Gegenwart wichtigsten geschichtlichen Formkräfte Chinas stammten aus der Zeit der mandschurischen Qing-Dynastie (1644–1912), nämlich die Gestalt als multiethnisches Imperium von enormer Ausdehnung und das autoritär-zentralistische Ordnungsmodell. Westad sieht im Fortwirken der imperialen Erbschaft des Qing-Reichs eine gewisse Ironie, da eine Han-nationalistisch inspirierte Geschichtsschreibung nach 1912 viel Aufwand betrieben habe, die historische Bedeutung der „fremden“ Qing-Dynastie für China zu bestreiten. Skeptisch ist er gegenüber verbreiteten Deutungen einer ungebrochenen Kontinuität der chinesischen Geschichte: Es irre sich wer glaubt, Strategien der heutigen Volksrepublik könnten aus der Lektüre von 2.500 Jahre alten Texten wie der Kriegskunst von Sun Zi erschlossen werden.
Detaillierte Ausführungen zu Akteuren und Institutionen der außenpolitischen Arbeitsprozesse liefert Zhao Suisheng in Kapitel 5. Er behandelt China, anders als die meisten Autoren des Bandes, nicht nach dem vereinfachenden Modell eines Einzelakteurs, sondern blickt ins Innere der Black Box. Die seit den 2010er Jahren steigende Rolle der Außenpolitik zeige sich u. a. darin, dass Xi ihr mindestens die Hälfte seiner Arbeitszeit widme, mehr als seine Vorgänger. Außenpolitische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse konzentrierten sich auf einen sehr kleinen Personenkreis.
In Kapitel 6 informiert Barry Naughton über die globalen Interaktionen von Chinas Wirtschafts-, Währungs- und Infrastrukturpolitik. Jahrzehnte eines außerordentlichen Wachstums haben China von einem armen, isolierten Agrarland in eine Handelsmacht mit relativ hohem Pro-Kopf-Einkommen und zur Zugmaschine der Weltwirtschaft verwandelt. Das „Wachstumswunder“ zwischen 1978 und 2010 habe das Potential Chinas als Niedriglohn- und Exportwirtschaft ausgeschöpft, so dass die exportfördernde Wirtschaftspolitik ab etwa 2005 an ihre Grenzen gestoßen sei. 2006 machten Exporte über 35 % des Bruttoinlandsprodukts aus; seitdem sank ihr Anteil auf mittlerweile unter 20 %. Auf den ökonomischen Strukturwandel und die von den USA ausgehende Finanzkrise 2008/09 reagierte Peking mit zwei längerfristigen Projekten: Erstens dem Versuch, den Renminbi zu internationalisieren und zweitens mit dem monumentalen Infrastrukturprojekt der „neuen Seidenstraße“. Während die Internationalisierung der Landeswährung derzeit in den Hintergrund getreten ist, komme der „neuen Seidenstraße“ eine zentrale Rolle zu. Würden viele Länder buchstäblich an die Volksrepublik angebunden, so verbessere sich Chinas Wettbewerbsposition und technische Standards könnten zu chinesischen Gunsten harmonisiert werden. Naughton unterstreicht, dass die Belt and Road Initiative keine multilaterale Organisation ist, sondern ein Geflecht von bilateralen Abkommen Chinas mit anderen Staaten und damit ein Mehrzweckinstrument der chinesischen Politik.
Wie das Kernstück des Buchs lesen sich die Kapitel 10 bis 15, die Chinas bilaterale und regionale Beziehungen behandeln. Robert Sutter bietet eine solide Bestandsaufnahme des sino-amerikanischen Verhältnisses, die gleichermaßen historische Phasen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt, allerdings wenig perspektivische Einordnung liefert. Als prägenden Faktor der gegenwärtigen Beziehungen macht er eine härter werdende Chinapolitik der USA aus.
Das Kapitel China’s Relations with Russia von Alexei Voskressinski wäre treffender mit Russia’s Relations with China überschrieben, da der Autor fast nur die russische Perspektive darlegt und man über die chinesische Sicht auf Russland kaum mehr als einen Absatz liest. Für China sei Russland wertvoll, um den eigenen Aufstieg zur Weltmacht abzusichern – ohne die konfrontative russische Haltung gegenüber dem Westen könne eine anti-chinesische Koalition entstehen und über Moskau erhalte man Zugang zu Rüstungs- und Energiemärkten, die nicht vom Westen abhängig sind.
Gut gelungen ist François Godements Darstellung der chinesisch-europäischen Beziehungen. Offiziell werden diese als „umfassende strategische Partnerschaft“ bezeichnet; tatsächlich sei das Verhältnis zwar umfassend, jedoch weder strategisch noch eine Partnerschaft, wolle man diese Begriffe nicht sinnentleeren. Im Wesentlichen liege hier eine (negative) Zusicherung an die jeweils andere Seite vor, keinen offenen strategischen Konflikt einzugehen. Der Ausdruck „strategisch“ bedeute für China nur die Abwesenheit von größeren Konflikten mit Europa, insbesondere sicherheitspolitischer Art.
Michael Yehudas Kapitel über die asiatisch-pazifische Region ist ebenfalls informativ, wenngleich man den vielschichtigen und komplexen Beziehungen Chinas zu seinen Nachbarstaaten insgesamt mehr Text gönnen würde. Während aus Sicht Pekings zweifellos Nordostasien mit der Koreanischen Halbinsel und Japan die strategisch prioritäre Region sei, erstrecke sich der chinesische Einfluss mittlerweile auf ganz Asien, da China seit den 1990er Jahren die USA und Japan sukzessive als wichtigste Handelspartner fast aller asiatischen Länder abgelöst hat. Das Reich der Mitte bildet das Zentrum komplexer Produktionsketten und es bestehen entsprechende asymmetrische Interdependenzen.
Eine erhebliche Asymmetrie der Machtverhältnisse, die nur rhetorisch minimiert werde, charakterisiert auch Pekings Beziehungen zu den Ländern in Afrika, Lateinamerika und Nahost, die im Kapitel von Eisenman und Heginbotham behandelt werden. Größere Entwicklungs- und Schwellenländer seien als „aufstrebende Mächte“ (xīnxīng dàguó) v. a. seit 2008/09 wichtige Adressaten von Chinas Außenpolitik. Das chinesische Handelsvolumen mit den Entwicklungsländern wuchs inflationsbereinigt von 29,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 1990 auf 1.400 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017, hat sich also um den Faktor 47 vervielfacht.
In Kapitel 15 analysiert Srikanth Kondapalli den von Peking so bezeichneten „Multilateralismus neuen Typs“ (xīnxíng duōbiān zhǔyì). Bemerkenswert ist, wie viele neue internationale und regionale Strukturen China in den letzten 25 Jahren ins Leben gerufen hat. Institutionen wie das Forum on China-Africa Cooperation transportierten die vorhandene Asymmetrie schon semantisch, da China hier auf einer Ebene mit ganzen Weltregionen stehe.
Im Schlusskapitel richtet Shambaugh den Blick in die nahe Zukunft und skizziert die kommenden Herausforderungen für Chinas Außenbeziehungen. Diese müssten sich sieben wesentlichen Problemfeldern stellen: 1. die Auswirkungen der inneren Lage Chinas, 2. die Beziehungen zu den USA, 3. die Beziehungen zu Russland, 4. die Beziehungen zu den Nachbarn in Asien, 5. das Projekt der „neuen Seidenstraße“, 6. das ambivalente Verhältnis Chinas zur Global Governance, bei dem sich eine starke Status quo-Orientierung mit revisionistischen Elementen mischten und schließlich 7. die Schwierigkeiten der Volksrepublik, Soft Power im Sinne einer „Macht durch Anziehung“ zu entfalten.
China and the World ist ein zuverlässiges Lehrbuch. In künftigen Ausgaben dürfte es weiter anwachsen, da der Band als solcher zwar eine Lücke schließt, jedoch bisher selbst noch einige Leerstellen lässt: Theorien der internationalen Beziehungen oder der Außenpolitikanalyse spielen keine Rolle, ebenso wenig wie Chinas Strategiedebatten und außenpolitische Denkschulen. Noch ausführlicher hätten die Energie- und Rohstoffpolitik sowie die internationalen Dimensionen von Forschung und Technologie thematisiert werden können. Zur Umwelt- und Klimapolitik findet sich bislang nichts; wenig erfährt man über die Bedeutung der sub-staatlichen Akteure in Chinas Außenbeziehungen: Provinzen, Städte, Unternehmen und Spitzenuniversitäten. Schließlich fehlt auch die Gesundheitspolitik, von der bei der Drucklegung freilich niemand ahnen konnte, wie dramatisch ihre internationalen Dimensionen im Jahr 2020 hervortreten würden. Es lässt sich nur spekulieren, welche längerfristigen weltpolitischen Folgen die Coronavirus-Pandemie haben wird, doch zu einer Verbesserung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen hat SARS-CoV-2 gewiss nicht beigetragen.
© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die (unvollkommene) Rückkehr der Abschreckung
- Auf der Suche nach politischer Rationalität nuklearer Abschreckung
- Neue Herausforderungen erfordern neue Ideen: Elemente einer Theorie des Sieges in modernen strategischen Konflikten
- Zur Bedeutung von Kernwaffen unter Bedingungen strategischer Rivalität – analytische Denkanstöße
- Iran und Israel: Ist ein Krieg unvermeidlich?
- Kurzanalysen und Berichte
- Erdogan schafft im Windschatten von Corona in Libyen Fakten!
- Geopolitische Folgen und Herausforderungen der Coronakrise für die Ukraine
- Forum – welche Politik ist angesagt gegenüber China und Russland?
- Anregungen zu einer neuen transatlantischen China-Politik
- Russlandpolitik in der Kontroverse
- Russlandpolitik in der Kontroverse
- Ergebnisse strategischer Studien
- Russland
- Sergey Sukhankin: Instruments of Russian Foreign Policy: Special Troops, Militias, Volunteers, and Private Military Enterprises. Washington, D.C.: The Jamestown Foundation, 2019
- Richard Sokolsky/Eugene Rumer: U.S.-Russian Relations in 2030. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, Juni 2020
- Mathieu Boulègue/Orysia Lutsevych: Resilient Ukraine. Safeguarding Society from Russian Aggression. London: Chatham House, Juni 2020
- Naher Osten
- Peter Salisbury: Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy. London: Chatham House, Juli 2020
- Ilan Goldenberg/Elisa Catalano Ewers/Kaleigh Thomas: Reengaging Iran. A New Strategy for the United States. Washington D.C.: CNAS, August 2020
- International Crisis Group: Taking Stock of the Taliban’s Perspectives on Peace. Brüssel, August 2020
- Europäische Sicherheit
- Peter Rudolf: Deutschland, die NATO und die nukleare Abschreckung. Berlin: SWP, Mai 2020
- Jana Puglierin/Ulrike Esther Franke: The big engine that might: How France and Germany can build a geopolitical Europe. Berlin/London: European Council on Foreign Relations, Juli 2020
- Digitale Sicherheit
- Kenneth Geers: Alliance Power for Cyber Security. Washington, D.C.: The Atlantic Council, August 2020
- Daniel Kliman/Andrea Kendall-Taylor/Kristine Lee/Joshua Fitt/Carisa Nietsche: Dangerous Synergies. Countering Chinese and Russian Digital Influence Operations. Washington, D.C.: Centers for a New American Security, Juni 2020
- JD Work/Richard Harknett: Troubled vision: Understanding recent Israeli-Iranian offensive cyber exchanges. Washington D.C.: The Atlantic Council, Juli 2020
- Ökonomische Aspekte des internationalen Wandels
- Bayern LB Research/Prognos: Das Ende der Globalisierung – braucht Deutschland ein neues Geschäftsmodell? Wie Unternehmen jetzt die Weichen richtig stellen. München: Prognos, Juni 2020
- Buchbesprechungen
- David Shambaugh (Hg.): China and the World. New York: Oxford University Press 2020, 394 Seiten
- Tingyang Zhao: Alles unter einem Himmel. Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung. Berlin: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2020, 266 Seiten
- Campbell Craig/Frederik Logevall: America’s Cold War. The Politics of Insecurity. Second Edition. Cambridge, MA und London: Harvard University Press 2020, 443 Seiten
- Christopher Hill: The Future of British Foreign Policy. Security and Diplomacy in a World after Brexit, London: Polity Press 2019, 238 Seiten
- Jason Lyall: Divided Armies. Inequality & Battlefield Performance in Modern War. Princeton und Oxford: Princeton University Press 2020, 528 Seiten
- Ben Saul/Dapo Akande: The Oxford Guide to International Humanitarian Law. Oxford: Oxford University Press 2020, 480 Seiten
- James D. Bindenagel: Germany from Peace to Power. Can Germany lead in Europe without dominating? Bonn: Bonn University Press 2020, 223 Seiten
- Bildnachweise
- Iran and Israel: The Inevitable War?
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die (unvollkommene) Rückkehr der Abschreckung
- Auf der Suche nach politischer Rationalität nuklearer Abschreckung
- Neue Herausforderungen erfordern neue Ideen: Elemente einer Theorie des Sieges in modernen strategischen Konflikten
- Zur Bedeutung von Kernwaffen unter Bedingungen strategischer Rivalität – analytische Denkanstöße
- Iran und Israel: Ist ein Krieg unvermeidlich?
- Kurzanalysen und Berichte
- Erdogan schafft im Windschatten von Corona in Libyen Fakten!
- Geopolitische Folgen und Herausforderungen der Coronakrise für die Ukraine
- Forum – welche Politik ist angesagt gegenüber China und Russland?
- Anregungen zu einer neuen transatlantischen China-Politik
- Russlandpolitik in der Kontroverse
- Russlandpolitik in der Kontroverse
- Ergebnisse strategischer Studien
- Russland
- Sergey Sukhankin: Instruments of Russian Foreign Policy: Special Troops, Militias, Volunteers, and Private Military Enterprises. Washington, D.C.: The Jamestown Foundation, 2019
- Richard Sokolsky/Eugene Rumer: U.S.-Russian Relations in 2030. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, Juni 2020
- Mathieu Boulègue/Orysia Lutsevych: Resilient Ukraine. Safeguarding Society from Russian Aggression. London: Chatham House, Juni 2020
- Naher Osten
- Peter Salisbury: Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy. London: Chatham House, Juli 2020
- Ilan Goldenberg/Elisa Catalano Ewers/Kaleigh Thomas: Reengaging Iran. A New Strategy for the United States. Washington D.C.: CNAS, August 2020
- International Crisis Group: Taking Stock of the Taliban’s Perspectives on Peace. Brüssel, August 2020
- Europäische Sicherheit
- Peter Rudolf: Deutschland, die NATO und die nukleare Abschreckung. Berlin: SWP, Mai 2020
- Jana Puglierin/Ulrike Esther Franke: The big engine that might: How France and Germany can build a geopolitical Europe. Berlin/London: European Council on Foreign Relations, Juli 2020
- Digitale Sicherheit
- Kenneth Geers: Alliance Power for Cyber Security. Washington, D.C.: The Atlantic Council, August 2020
- Daniel Kliman/Andrea Kendall-Taylor/Kristine Lee/Joshua Fitt/Carisa Nietsche: Dangerous Synergies. Countering Chinese and Russian Digital Influence Operations. Washington, D.C.: Centers for a New American Security, Juni 2020
- JD Work/Richard Harknett: Troubled vision: Understanding recent Israeli-Iranian offensive cyber exchanges. Washington D.C.: The Atlantic Council, Juli 2020
- Ökonomische Aspekte des internationalen Wandels
- Bayern LB Research/Prognos: Das Ende der Globalisierung – braucht Deutschland ein neues Geschäftsmodell? Wie Unternehmen jetzt die Weichen richtig stellen. München: Prognos, Juni 2020
- Buchbesprechungen
- David Shambaugh (Hg.): China and the World. New York: Oxford University Press 2020, 394 Seiten
- Tingyang Zhao: Alles unter einem Himmel. Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung. Berlin: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2020, 266 Seiten
- Campbell Craig/Frederik Logevall: America’s Cold War. The Politics of Insecurity. Second Edition. Cambridge, MA und London: Harvard University Press 2020, 443 Seiten
- Christopher Hill: The Future of British Foreign Policy. Security and Diplomacy in a World after Brexit, London: Polity Press 2019, 238 Seiten
- Jason Lyall: Divided Armies. Inequality & Battlefield Performance in Modern War. Princeton und Oxford: Princeton University Press 2020, 528 Seiten
- Ben Saul/Dapo Akande: The Oxford Guide to International Humanitarian Law. Oxford: Oxford University Press 2020, 480 Seiten
- James D. Bindenagel: Germany from Peace to Power. Can Germany lead in Europe without dominating? Bonn: Bonn University Press 2020, 223 Seiten
- Bildnachweise
- Iran and Israel: The Inevitable War?

