Zusammenfassung
Dieser Beitrag beleuchtet die neuen Herausforderungen, die den drei Landesbibliotheken in Nordrhein-Westfalen (NRW) durch das 2022 erlassene Kulturgesetzbuch NRW gestellt worden sind, und nimmt dabei Aspekte von Erschließung, Erhaltung und Digitalisierung des kulturellen schriftlichen Erbes in NRW in den Blick.
Abstract
The article describes new challenges for North Rhine-Westphalia’s State Libraries since the 2022 cultural code NRW was decreed, focusing on aspects of indexing, preserving, and digitizing written cultural heritage in North Rhine-Westphalia.
1 Einleitung
Durch das am 1. Januar 2022 in Kraft getretene Kulturgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (KulturGB NRW) sind die Aufgaben der drei Universitäts- und Landesbibliotheken (ULB) Bonn, Düsseldorf und Münster erheblich ausgeweitet worden[1]. In den §§ 52 und 56 bis 62 sind diese explizit festgehalten: die Sammlung, Erschließung, Bewahrung und Bereitstellung der Pflicht- und Regionalliteratur und die Erschließung der landesspezifischen Literatur in der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie (NWBib). Ein Konzept für die Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Archivierung regionaler Webseiten wird zurzeit mit dem Hochschulbibliothekszentrum (hbz) entwickelt.
Eine neue Herausforderung für die drei Landesbibliotheken (LBB) sind die im KulturGB NRW beschriebenen weiteren Verpflichtungen, die über das klassische Aufgabenspektrum der Landesbibliotheken hinausgehen: der Schutz des historischen schriftlichen Kulturerbes des Landes durch „sachgerechte Aufbewahrung und Erschließung sowie durch geeignete Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung“ (§ 52,3). Hinzu kommt, dass die Landesbibliotheken andere Bibliotheken in öffentlicher oder privater Trägerschaft bei der Erschließung, Bewahrung und Digitalisierung ihrer wertvollen historischen Bestände unterstützen sollen – eine zweifellos wichtige Aufgabe, die in den nächsten Jahren ausgestaltet werden muss. Aufgrund dieser gesetzlichen Verpflichtung zur Erschließung, Erhaltung und Digitalisierung des schriftlichen Kulturerbes aus Nordrhein-Westfalen (NRW) bedarf es neuer Konzepte und einer Ausfinanzierung durch das Land. Erste Schritte im Bereich der Bestandserhaltung sind bereits durch die Verstetigung der Mittel im Landesbibliothekshaushalt erfolgt.
Ein wichtiges Instrument für die Ausgestaltung insbesondere der neuen Aufgaben der drei Landesbibliotheken ist die dreimal jährlich stattfindende Landesbibliothekenkonferenz, an der die Leitenden Direktor*innen der drei ULB, Vertreterinnen des Ministeriums sowie die in den Landesbibliotheken zuständigen Mitarbeitenden sowie das hbz teilnehmen. Sämtliche Aufgaben, die sich aus dem Kulturgesetzbuch ergeben, werden hier diskutiert und beraten. Für einzelne Themen werden auf operativer Ebene Arbeitsgemeinschaften gebildet, z. B. für die Frage der Webarchivierung oder der Kulturgutdigitalisierung.
Die neue Webseite[2] der drei Landesbibliotheken spiegelt dieses neue erweiterte Aufgabenspektrum der drei Landesbibliotheken bereits wider. Im Mittelpunkt stehen die Produkte der Landesbibliotheken: die Sammlung der Pflichtliteratur, die Nordrhein-Westfälische Bibliographie, die Elektronischen Publikationen aus NRW (E-Pflicht), das Portal „zeit.punktNRW“ mit seinen digitalisierten historischen Zeitungen aus NRW, das Biographische Portal NRW, kulturgut.digital.NRW, die Historischen Sammlungen der drei Landesbibliotheken, der Kulturgutschutz sowie die im Aufbau befindliche Webseitenarchivierung.
Im Folgenden sollen die einzelnen Aufgabenfelder der drei Landesbibliotheken in NRW genauer beleuchtet werden.
2 Kulturgut erschließen
Die Erschließung des schriftlichen Kulturerbes in NRW erstreckt sich über verschiedene Produkte der Landesbibliotheken. Neben gedruckten Publikationen werden auch elektronische Publikationen und zukünftig Webseiten erschlossen. Die Erschließung erfolgt bei allen Ressourcen mithilfe der Bibliothekssoftware Alma der Firma Ex Libris. Über Schnittstellen können die Publikationen mit den zugehörigen Metadaten (meist über Nacht) in die Präsentationsportale eingespielt werden.
Mithilfe verschiedener Softwarelösungen werden die unterschiedlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Elektronische Publikationen werden nach der Erschließung in Alma über die Visual Library (VL) der Firma semantics GmbH[3] in der jeweiligen E-Pflichtsammlung der drei LBB freigegeben und präsentiert.[4]
Für die Webseitenarchivierung wird vom hbz in Köln zurzeit ein intern einzusehendes Archivierungs- und Präsentationssystem aufgebaut. Die archivierten Webseiten werden auch hier mit Alma erschlossen und zudem in der NWBib sichtbar sein.
Die NWBib ist eine gemeinsame Webseite der drei LBB, die die Daten aus Alma präsentiert.[5] In der NWBib werden die Publikationen mit thematischem Bezug zu NRW seit 1983 verzeichnet. Aufgenommen werden selbstständige Literatur wie Bücher, Zeitschriften und Zeitungen sowie unselbstständige Werke wie unter anderem Aufsätze aus Sammelwerken oder Jahrbüchern. Außerdem werden Karten, Textdatenträger und Ton- und Tonbildträger verzeichnet. Seit 2013 werden auch Netzpublikationen verzeichnet, die aus der VL heraus mit der NWBib verknüpft werden.
Ein weiteres Produkt der nordrhein-westfälischen LBB ist das Biographische Portal NRW.[6] Darin werden Biogramme und Literatur zu Persönlichkeiten aus NRW zusammengetragen und zentral in dieser Datenbank abrufbar gemacht. Die Datenbasis bilden die Personenschlagworte der NWBib. Über eine Schnittstelle können die in der NWBib verknüpften Personendatensätze der Gemeinsamen Normdatei (GND) abgefragt werden. Sind diese GND-Personendatensätze noch unvollständig, werden sie von Mitarbeitenden der ULB Düsseldorf und der ULB Münster aufgearbeitet. Anschließend werden sie in das Biographische Portal NRW eingespielt.
Technische Unterstützung leistet für die drei Landesbibliotheken das hbz in Köln. Im KulturGB NRW § 52, Abs. 5 ist diese Aufgabe sogar gesetzlich verankert worden. Das hbz stellt die technische Infrastruktur für die Webseite der NWBib bereit, entwickelt deren Infrastruktur weiter und setzt die Langzeitarchivierung um. 2002 war eine eigene Oberfläche für die NWBib entstanden, die zwischen 2014 und 2016 vom hbz modernisiert wurde.[7] Seitdem basiert der Webauftritt auf der lobid-API.
Lobid ist der Linked Open Data-Dienst des hbz und bietet neben Rechercheoberflächen auch webbasierte Schnittstellen (API) an.[8] Datensets aus verschiedenen Quellen kommen in lobid zusammen, die dann webkonform und unter der CC0-Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören unter anderem die Daten des hbz-Verbundkatalogs und der Zugriff auf die GND. Auf Basis der RDF-Version der GND können die GND-Daten in die lobid-Rechercheoberfläche eingebunden und durchsucht werden. Die LBB in NRW sind Teil des NRW-Bibliotheksverbunds und die Titeldaten der NWBib sind auch im hbz-Verbundkatalog zu finden.
2023 entstand ein neues Projekt in Kooperation mit dem hbz durch ein Studienprojekt von Hannah Metzner im Rahmen des MALIS-Studiengangs an der TH Köln. Im Fokus des Projekts stand die NWBib-Sachsystematik mit ihren über 1.000 Systemstellen.[9] Diese werden standardmäßig im Prozess der Sacherschließung vergeben. Da die Publikationen, die in die NWBib aufgenommen werden, intellektuell ausgewertet werden, besteht der Bedarf, neues Personal in die Vergabe der zahlreichen Notationen umfassend einzuweisen. Vor dem Projekt hatte es jedoch keine einheitliche Dokumentation zur Verwendung der Sachnotationen gegeben.
Das Projekt verfolgte zwei Ziele: Zum einen sollte eine Arbeitsgrundlage für die Erschließung in der NWBib (zunächst an der ULB Düsseldorf) geschaffen werden. Zum anderen wurde die Sachsystematik mit der GND und mit Wikidata abgeglichen. Die GND und Wikidata zu verknüpfen, ist bereits etablierte Praxis im Bereich der Normierung und der inhaltlichen Erschließung. Durch das Projekt, dessen Ergebnisse dauerhaft sichtbar gemacht werden, kann die Standardisierung der NWBib-Sachsystematik unterstützt werden.
Die Umsetzung des Projekts erfolgte mithilfe des Datenmodels SKOS.[10] Bereits vor dem Projekt gab es die SKOS-Datei der NWBib-Sachsystematik. Diese wird vom hbz gepflegt.[11] Verschiedene Elemente in der SKOS-Datei strukturieren die Datei. Mithilfe dieser Elemente werden auch die im Projekt eingefügten Verwendungshinweise für die Notationen und die Verknüpfungen mit GND und Wikidata dargestellt.[12] Die GND- und Wikidata-Verweise können auch für externe Nutzende der NWBib interessant sein, sodass sie zukünftig in der NWBib-Sachsystematik eingebunden werden. Bei Bedarf können weitere Bearbeitende aus den LBB in NRW für den im Projekt entstandenen Workflow freigeschaltet werden und an der SKOS-Datei mitarbeiten.
3 Kulturgut erhalten
Das Land Nordrhein-Westfalen verfügt über ein reiches schriftliches Kulturgut, das in den Archiven und Bibliotheken des Landes verwahrt wird. Bei dem Bibliotheksgut handelt es sich u. a. um Handschriften, Nachlässe, Inkunabeln, alte Drucke aus dem Zeitraum von 1501 bis ca. 1830 sowie eine reiche Pflicht- und Regionalliteratur.
Das Land fördert seit 2007 in verschiedenen Förderphasen Bestandserhaltungsmaßnahmen in den vier großen Altbestandsbibliotheken des Landes: den Universitäts- und Landesbibliotheken in Bonn, Düsseldorf und Münster sowie der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. Die vier Bibliotheken haben seit 2007 bei der Konzeption und Durchführung von Bestandserhaltungsprojekten gut zusammengearbeitet. Sie haben gemeinsam Konzepte und Anträge erarbeitet, die im zuständigen Ministerium eingereicht und auch bewilligt worden sind. Die einzelnen Einrichtungen stellten anschließend jeweils konkrete Einzelanträge inklusive Kostenplan bei den zuständigen Bezirksregierungen in Düsseldorf, Köln und Münster. Bei diesen sind abschließend auch die Verwendungsnachweise einzureichen. Zu den so finanzierten Bestandserhaltungsprojekten zählen vor allem Maßnahmen, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) nicht bezahlt werden, z. B. Einzelrestaurierungen oder Verfilmungs- und Digitalisierungsmaßnahmen. Mit der Durchführung der einzelnen Maßnahmen sind Dienstleister beauftragt worden.
Die KEK selbst hat in den letzten Jahren zahlreiche weitere Bestandserhaltungsprojekte in Nordrhein-Westfalen finanziert. Hier konzentriert sich die Förderung auf Massenverfahren wie etwa großflächige Reinigungskampagnen, Neuverpackungen oder Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen, die ganze Bestandsgruppen betreffen. Leider ist die Beantragung von Fördermitteln bei der KEK deutlich aufwändiger und unsicherer als bei den Landesmitteln. Da die beiden Förderlinien (BKM-Sonderprogramm und KEK-Modellprojektförderung) häufig überzeichnet sind – es werden mehr Mittel beantragt als Geld zur Verfügung steht –, können nicht alle Anträge bewilligt werden. Die Mittelzusage kommt relativ spät im Jahr, so dass es schwierig wird, einen Dienstleister zu finden. Der Durchführungszeitraum ist auf das Kalenderjahr beschränkt, während man bei den Landesmitteln noch maximal acht Wochen ins Folgejahr gehen kann. Damit steht den Dienstleistern deutlich weniger Zeit zur Abwicklung der Projekte zur Verfügung. Schließlich erfordern auch die Verwendungsnachweise der KEK deutlich mehr Aufwand als dies bei den Landesmitteln der Fall ist.
Das Kulturgesetzbuch NRW verpflichtet in § 52 (3) die Universitäts- und Landesbibliotheken in NRW, das schriftliche kulturelle Erbe sowie historisch und kulturell bedeutsame Bestände durch geeignete Maßnahmen wie Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung zu schützen. Wurden solche Aktivitäten vorher im Wesentlichen durch Projektmittel des Landes oder der KEK unterstützt, hat das Ministerium als erste Maßnahme im Jahre 2023 gemeinsam mit den Landesbibliotheken vereinbart, die im Haushalt eingestellten Bestandserhaltungsmittel aus ihrem projekthaften Charakter zu befreien und in den regulären Haushalt der Landesbibliotheken zu überführen. Diese Mittelumwidmung, die zudem für enorme bürokratische Entlastung der Landesbibliotheken in dieser Frage sorgt, zeigt, dass die Bestandserhaltung historischer Bestände als eine Daueraufgabe erkannt worden ist, allein aufgrund der schieren Masse und der umfangreichen Schäden an den historischen Beständen. Schäden an den Werken, die sich aufgrund von Umwelteinflüssen, chemischen und biologischen Zersetzungsprozesse ergeben, lassen sich nur aufhalten, aber letztlich nicht verhindern und bedürfen deshalb der ständigen Bearbeitung.
Die vier großen Altbestandsbibliotheken führen nicht nur Bestandserhaltungsmaßnahmen durch, die die eigenen Bestände betreffen. Sie kooperieren zugleich mit Partnern vor Ort und in der Region und unterstützen diese bei Maßnahmen zur Bestandserhaltung oder beraten aktuell Einrichtungen bei Büchern mit Arsenverdacht. Die Kooperationspartner können unterschiedlich sein: an der eigenen Hochschule Seminar- und Institutsbibliotheken, die gerade in den geisteswissenschaftlichen Fächern nicht selten einen umfangreichen wertvollen Altbestand besitzen, vor Ort und in der Region die Partner in den Notfallverbünden zur gegenseitigen Unterstützung in Katastrophenfällen, perspektivisch in der weiteren Region wiederum gemäß Kulturgesetzbuch NRW (§ 52 (3)) andere Bibliotheken in öffentlicher oder privater Trägerschaft mit wertvollen Beständen.
4 Kulturgut digitalisieren
4.1 kulturgut.digital.nrw
Das Land NRW hat den Schutz von kulturellen Gütern durch Originalerhalt und Digitalisierung – auch der kleinen Einrichtungen – bereits seit längerer Zeit als wichtige Aufgabe erkannt (z. B. im Kulturfördergesetz 2014 sowie in Form von zwei Kulturförderplänen 2016–2018 und 2019–2023).[13]
Wie bereits eingangs beschrieben, sind Landesbibliotheken laut KulturGB NRW, § 52, Abs. 3 dafür verantwortlich, „andere Bibliotheken in öffentlicher oder privater Trägerschaft mit wertvollen Beständen“ zu unterstützen. Die praktische Frage, die sich den Landesbibliotheken nun stellt, lautet: Was genau ist unter dieser Unterstützungsleistung zu verstehen? Um genau diese Frage kreisten einige Gespräche zwischen den Landesbibliotheken und dem Ministerium, das darum bat, im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft die Bedarfe, Möglichkeiten und Grenzen auszuloten, um auf dieser Basis die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung dieser Aufgabe zu ermitteln – grundsätzlich vorstellbar sind Unterstützungsleistungen in diversen Teilbereichen der Digitalisierung: technisch, organisatorisch, beratend, schulend. Von großem Vorteil dabei ist die bereits seit vielen Jahren existierende Zusammenarbeit der drei Landesbibliotheken in NRW gemeinsam mit dem hbz in Köln. Hierdurch haben die genannten Einrichtungen die Erfahrung und die technische und organisatorische Expertise erlangt, um mit kleineren Einrichtungen Digitalisierungsprojekte durchzuführen. Allerdings sind noch zahlreiche Vorüberlegungen anzustellen, Gespräche mit entscheidenden Playern zu führen und offene Fragen zu klären. Was aber jetzt schon klar sein dürfte: Ein solches Landesdigitalisierungsprogramm muss zwingend auf vielfältigen Kooperationen zwischen Landesbibliotheken und unterschiedlichsten Einrichtungen des Landes mit historisch wertvollem Kulturgut basieren und folgende langfristige Ziele verfolgen:
„Unsichtbare Bestände“ (nichtkatalogisiert, nichtdigitalisiert) werden sichtbar und durch Einspielung in überregionale Portale (Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana) für vielfältige Anwendungszwecke nutzbar gemacht (u. a. Ausstellungen, Bildung, Forschung).
In Ergänzung zur Sicherung der Originale durch Bestandserhaltung werden wertvolle Kulturgüter durch den stattfindenden Medienwechsel nachhaltig für zukünftige Generationen digital gesichert.
Im Sinne von Open Science und Open Data (Zukunftsvertrag NRW, Z. 3264 f., 3633) wird eine Vielzahl von Quellen für Wissenschaft und Citizen Science geschaffen. Die Beteiligung von Bürger*innen an digitaler Entwicklung wird dadurch ermöglicht.
4.2 zeit.punktNRW
Ein bereits seit Jahren etabliertes Digitalisierungsprojekt in NRW belegt, wie wichtig das kooperative Element für den Erfolg solcher Vorhaben ist. Gemeint ist das 2017 gestartete Zeitungsdigitalisierungsprojekt „zeit.punktNRW“,[14] welches auf der engen Zusammenarbeit der drei Landesbibliotheken in NRW im Verbund mit dem hbz in Köln basiert. Ferner spielt die Kooperation mit den beiden Landschaftsverbänden in NRW eine ebenso große Rolle wie diejenige mit technischen Dienstleistern für Soft- und Hardware oder für outgesourcte Digitalisierungsmaßnahmen. Ein solches Projekt wäre ohne die Kooperationsbereitschaft der zahlreichen Stadt-, Kreis-, Kommunal- und Gemeindearchive (103 der aktuell 116 Projektpartner sind Archive) aber letztlich zum Scheitern verurteilt. Von der anderen Seite gesehen: Gerade für kleinere Archive ist ein solches Projekt eine wohl einmalige Gelegenheit, ihre historischen Zeitungsbestände zu digitalisieren und weltweit zu präsentieren. Schließlich wäre ein solches Projekt ohne die finanzielle und ideelle Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes NRW in dieser Form kaum denkbar. Mit aktuell ca. 16,5 Millionen freigegebenen Images ist es das größte deutsche Regionalportal in Deutschland und ist zudem mittlerweile Hauptdatengeber des Deutschen Nationalen Zeitungsportals der DDB. Das Projekt befindet sich in der dritten Förderphase, bis Ende 2025 sollen 20 Millionen Zeitungsseiten digitalisiert und online gestellt sowie per Volltextrecherche durchsuchbar sein. Eine vierte und letzte Förderphase bis Ende 2028 ist bereits in Planung. Am Ende des Projekts sollen ca. 27 Millionen Zeitungsseiten im Zeitungsportal online sein, welches anschließend in die Hände der Landesbibliotheken in NRW und des hbz als verstetigte kooperative Struktur übergehen soll. Es sei schließlich erwähnt, dass sich durch die Digitalisierung historischer Zeitungen und ihrer Onlinestellung zunehmend neue Felder eröffnen, die das digitalisierte Zeitungsmaterial zum Ausgangspunkt für neue Forschungen machen, wie dies vermehrt in den Digital Humanities zu beobachten ist. Hierin zeigt sich einmal mehr, welch enormes Potenzial in der Beschäftigung mit historischen Zeitungen steckt.[15]
Über die Autoren
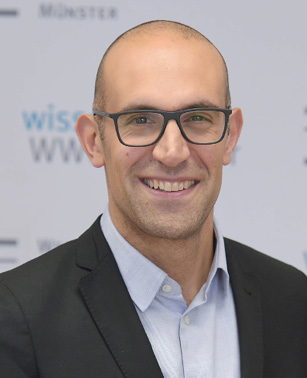
Dr. Andrea Ammendola

Dr. Michael Herkenhoff
© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
Artikel in diesem Heft
- Frontmatter
- Editorial
- Aus den Verbänden
- Bibliotheken sichern das kulturelle Erbe
- Kindersoftwarepreis TOMMI: Kinderjury in Bibliotheken gestartet
- Tagungsberichte
- Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific
- Themenheft: Das Pflichtexemplar in Deutschland – Stand und Perspektive
- Das Pflichtexemplar in der Deutschen Nationalbibliothek
- Das Pflichtexemplar in Baden-Württemberg
- Das Pflichtexemplar in Bayern
- Das Pflichtexemplar in Berlin
- Das Pflichtexemplar in Brandenburg
- Das Pflichtexemplar in Bremen
- Das Pflichtexemplar in Hamburg
- Das Pflichtexemplar in Hessen
- Das Pflichtexemplar in Mecklenburg-Vorpommern
- Das Pflichtexemplar in Niedersachsen
- Das Pflichtexemplar in Nordrhein-Westfalen
- Das Pflichtexemplar in Rheinland-Pfalz
- Das Pflichtexemplar im Saarland
- Das Pflichtexemplar in Sachsen
- Das Pflichtexemplar in Sachsen-Anhalt
- Das Pflichtexemplar in Schleswig-Holstein
- Das Pflichtexemplar in Thüringen
- Notizen und Kurzbeiträge
- Notizen und Kurzbeiträge
Artikel in diesem Heft
- Frontmatter
- Editorial
- Aus den Verbänden
- Bibliotheken sichern das kulturelle Erbe
- Kindersoftwarepreis TOMMI: Kinderjury in Bibliotheken gestartet
- Tagungsberichte
- Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific
- Themenheft: Das Pflichtexemplar in Deutschland – Stand und Perspektive
- Das Pflichtexemplar in der Deutschen Nationalbibliothek
- Das Pflichtexemplar in Baden-Württemberg
- Das Pflichtexemplar in Bayern
- Das Pflichtexemplar in Berlin
- Das Pflichtexemplar in Brandenburg
- Das Pflichtexemplar in Bremen
- Das Pflichtexemplar in Hamburg
- Das Pflichtexemplar in Hessen
- Das Pflichtexemplar in Mecklenburg-Vorpommern
- Das Pflichtexemplar in Niedersachsen
- Das Pflichtexemplar in Nordrhein-Westfalen
- Das Pflichtexemplar in Rheinland-Pfalz
- Das Pflichtexemplar im Saarland
- Das Pflichtexemplar in Sachsen
- Das Pflichtexemplar in Sachsen-Anhalt
- Das Pflichtexemplar in Schleswig-Holstein
- Das Pflichtexemplar in Thüringen
- Notizen und Kurzbeiträge
- Notizen und Kurzbeiträge

