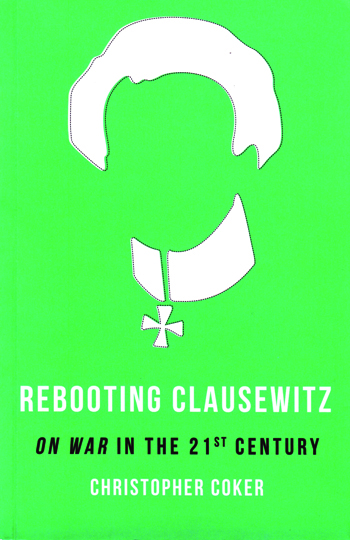
Carl von Clausewitz' Schriften wurden wiederholt für obsolet erklärt, v. a. aufgrund sich wandelnder Formen und Technologien des Krieges. Dies hat nur wenig an der Wertschätzung geändert, die dem preußischen Kriegstheoretiker insbesondere in den angloamerikanischen Strategic Studies entgegengebracht wird. Auch Christopher Coker, Professor an der London School of Economics and Political Science, spricht Clausewitz' Strategie- und Kriegstheorie zeitlose Qualität und einen so hohen Reflexionsgrad zu, dass sie selbst unter fundamental gewandelten Bedingungen ihre analytische Kraft nicht verliere.
Rebooting Clausewitz richtet sich nicht an Clausewitz-Fachleute, sondern an Studienanfänger, denen der Einstieg in eine etwas sperrige Thematik erleichtert werden soll. Auch wer zu keiner der beiden Gruppen gehört (wie der Rezensent), wird aus der Lektüre großen Gewinn und einiges Lesevergnügen ziehen. Cokers Buch ist ein Plädoyer, das rundum überzeugt.
Es besteht aus sechs Kapiteln, drei davon sind Essays: Eines über Clausewitz als Repräsentanten einer bestimmten Epoche, die er jedoch intellektuell transzendierte, das zweite über eine rückblickende Interpretation Clausewitz' durch das Prisma von Darwins Evolutionstheorie und ein drittes über die rhetorische Frage: If not Clausewitz then who? Die anderen Kapitel bestehen aus fiktionalen Dialogen, für die Coker Clausewitz in der Gegenwart auftreten lässt: vor Kadetten der US-Militärakademie in Westpoint, um über die Bedeutung von Theorie vorzutragen; in einer fiktiven Denkfabrik in Washington zu einer Diskussion über Strategie; schließlich im Military History Circle in London, um über den Sinn der Befassung mit Militärgeschichte zu debattieren.
In Sachbüchern sind kontrafaktische Betrachtungen und erst recht fiktionale Elemente ein sehr schmaler Grat, von dem sich die meisten seriösen Autoren aus guten Gründen fernhalten. Coker gelingt es jedoch bravourös, den Sinn der fortdauernden Beschäftigung mit Clausewitz dadurch zu demonstrieren, dass er ihn in neue und teils überraschende Zusammenhänge stellt, mit viel feiner Ironie. Der Text ist voller Querverbindungen zu einem breiten Spektrum an Disziplinen. Man lernt nebenbei vieles Interessante; in einigen Passagen wäre auch durch etwas weniger Information und eine konzisere Darstellung nichts verloren gegangen.
Das Buch hebt die Aktualität von Clausewitz in ihren vielen Facetten hervor, etwa seine kritische Betrachtung einer einseitigen Dominanz instrumenteller Rationalität im Krieg, der „Algebra des Handelns“. Auch hat Clausewitz im Gegensatz zu einem verbreiteten Vorurteil einiges über irreguläre und asymmetrische Kriegführung durch nicht-staatliche Akteure zu sagen. Ihm stand dabei u. a. die antinapoleonische Guerilla in Spanien (1808–1814) vor Augen, der der „kleine Krieg“ seinen Namen verdankt. Coker verweist auf Parallelen zum Irakkrieg seit 2003, sowohl in den großen Zusammenhängen als auch im taktischen Detail. Wie das US-Militär im Zweistromland sah sich die Grande Armée auf der Iberischen Halbinsel mit einem erbitterten, nicht unwesentlich von der Geistlichkeit ermunterten „Volkskrieg“ gegen eine modernistische und technologisch überlegene Besatzungsmacht konfrontiert. Spanien wurde durch den Krieg auf Jahrzehnte hin unregierbar; ähnlich ergeht es wohl dem Irak.
Bei seinem Auftritt in Washington lässt Coker Clausewitz die unstrategische Kultur des US-Militärs und der amerikanischen Führung kritisieren: Alles taktische und operative Geschick werde wertlos, wenn die sie überwölbenden Strategien und politischen Zwecke inkohärent, aberwitzig oder ganz abwesend sind. Technologische Überlegenheit könne weder eine schlechte oder fehlende Strategie noch das Nicht-Verstehen des Kriegsgegners kompensieren. Wer sich zum Krieg entscheidet, müsse genau wissen, welcher politische Zweck damit erreicht werden soll und wie dieser durch den Krieg zu erreichen ist. Was eigentlich banal klingt, ist nicht selbstverständlich: Die amerikanischen Kriegsziele in Vietnam, Afghanistan und dem Irak (2003) waren alles andere als eindeutig oder frei von Zielkonflikten. Anders sah es im Golfkrieg von 1990/91 aus.
Im letzten Kapitel gibt Coker Antworten auf seine Frage „Wer, wenn nicht Clausewitz?“: Clausewitz habe keine gleichrangigen peers im eigentlichen Sinne, lediglich die antiken Autoren Thukydides und Sun Tzu (Sunzi) könnten in einem Atemzug mit ihm genannt werden. Niemand habe die Clausewitz'schen Fragen vor ihm gestellt und nach ihm habe sie niemand mehr auf demselben Niveau und in derselben Tiefenschärfe behandelt. Coker sieht Clausewitz in mindestens neunfacher Hinsicht als Begründer oder Entdecker, darunter in folgenden Aspekten: Er sei der erste Theoretiker des Krieges gewesen; er habe als erster Strategie in einer systematischen Weise formuliert, ja Strategie als akademisches Fach überhaupt erst erfunden; er habe als erster Militärhistoriker im modernen Sinne gewirkt; er habe als erster die „Evolution“ des Krieges erkannt, natürlich avant la lettre und bevor er hätte Darwin lesen können. Aus diesen Gründen werde Vom Kriege der „Goldstandard“ der Strategie- und Kriegstheorie bleiben und jede Generation könne es auf eine neue Weise lesen.
© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Artikel in diesem Heft
- Cover und Titelseiten
- Cover und Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die Rolle von Abschreckung im neuen strategischen Umfeld Europas
- Die Dynamik der Abschreckung
- Abschreckung einst und heute
- Erweiterte Abschreckung in Asien: aktuelle Lehren für Europa
- Berichte und Kurzdarstellungen
- Die Trump-Präsidentschaft – Jahr 2
- Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump Administration
- Russische Marinedoktrin und maritime Rüstung: Anspruch und Realität
- Ergebnisse internationaler strategischer Analysen
- John Allen/ Philip M. Breedlove/ Julian Lindley-French/ George Zambellas: Future War NATO. From Hybrid War to Hyper War via Cyber War. 2017.
- Karl-Heinz Kamp/ Wolf Langheld: The Military Adaptation of the Alliance. 2017.
- Ian J. Brzezinski/ Tomáš Valášek: Reanimating NATO's Warfighting Mindset: Eight Steps to Increase the Alliance's Political-Military Agility. 2017
- Ted Piccone: Democracy and Cybersecurity. Brookings – Democracy and Security Dialogue Policy Brief Series. 2017
- Sarah Fainberg: Russian Spetsnaz, Contractors and Volunteers in the Syrian Conflict, Institut français des relations internationales (IFRI), Russie, Nei. 2017. Tom Parfitt: President Putin's Private Army Pays a High Price for Syria Success. 2017.
- Benjamin Herscovitch: A Balanced Threat Assessment of China's South China Sea Policy. 2017.
- Kroenig, Matthew/ Oh, Miyeon. A Strategy for the Trans-Pacific Century: Final Report of the Atlantic Council's Asia-Pacific Strategy Task Force. 2017.
- United Nations Office on Drugs and Crime: World Drug Report 2017. 2017.
- Tom Keatinge, Anne-Marie Barry: Disrupting Human Trafficking: The Role of Financial Institutions. 2017.
- Buchbesprechungen
- Brad Roberts: The Case for U.S. Nuclear Weapons in the 21st Century. 2016.
- Christine M. Leah, The Consequences of American Nuclear Disarmament. Strategy and Nuclear Weapons. 2017.
- Paul Cornish, Kingsley Donaldson: 2020. World of War. 2017.
- Christopher Coker, Rebooting Clausewitz. On War in the 21st Century. 2017.
- MichaelPaul, „Kriegsgefahr im Pazifik? Die maritime Bedeutung der sino-amerikanischen Rivalität“. 2017.
- Translated Articles (e-only)
- The Role of Deterrence in a new European strategic environment
- Deterrence Then and Now.
Artikel in diesem Heft
- Cover und Titelseiten
- Cover und Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die Rolle von Abschreckung im neuen strategischen Umfeld Europas
- Die Dynamik der Abschreckung
- Abschreckung einst und heute
- Erweiterte Abschreckung in Asien: aktuelle Lehren für Europa
- Berichte und Kurzdarstellungen
- Die Trump-Präsidentschaft – Jahr 2
- Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump Administration
- Russische Marinedoktrin und maritime Rüstung: Anspruch und Realität
- Ergebnisse internationaler strategischer Analysen
- John Allen/ Philip M. Breedlove/ Julian Lindley-French/ George Zambellas: Future War NATO. From Hybrid War to Hyper War via Cyber War. 2017.
- Karl-Heinz Kamp/ Wolf Langheld: The Military Adaptation of the Alliance. 2017.
- Ian J. Brzezinski/ Tomáš Valášek: Reanimating NATO's Warfighting Mindset: Eight Steps to Increase the Alliance's Political-Military Agility. 2017
- Ted Piccone: Democracy and Cybersecurity. Brookings – Democracy and Security Dialogue Policy Brief Series. 2017
- Sarah Fainberg: Russian Spetsnaz, Contractors and Volunteers in the Syrian Conflict, Institut français des relations internationales (IFRI), Russie, Nei. 2017. Tom Parfitt: President Putin's Private Army Pays a High Price for Syria Success. 2017.
- Benjamin Herscovitch: A Balanced Threat Assessment of China's South China Sea Policy. 2017.
- Kroenig, Matthew/ Oh, Miyeon. A Strategy for the Trans-Pacific Century: Final Report of the Atlantic Council's Asia-Pacific Strategy Task Force. 2017.
- United Nations Office on Drugs and Crime: World Drug Report 2017. 2017.
- Tom Keatinge, Anne-Marie Barry: Disrupting Human Trafficking: The Role of Financial Institutions. 2017.
- Buchbesprechungen
- Brad Roberts: The Case for U.S. Nuclear Weapons in the 21st Century. 2016.
- Christine M. Leah, The Consequences of American Nuclear Disarmament. Strategy and Nuclear Weapons. 2017.
- Paul Cornish, Kingsley Donaldson: 2020. World of War. 2017.
- Christopher Coker, Rebooting Clausewitz. On War in the 21st Century. 2017.
- MichaelPaul, „Kriegsgefahr im Pazifik? Die maritime Bedeutung der sino-amerikanischen Rivalität“. 2017.
- Translated Articles (e-only)
- The Role of Deterrence in a new European strategic environment
- Deterrence Then and Now.

