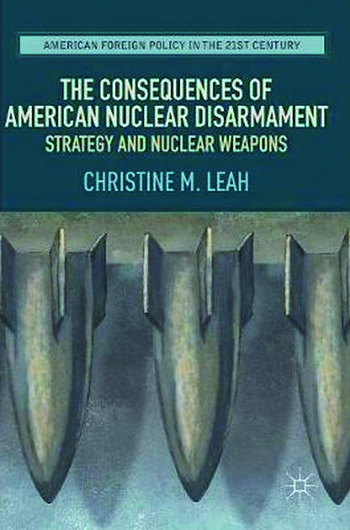
In diesem beherzten und zum Nachdenken provozierenden Buch fordert Christine M. Leah, eine Historikerin mit französisch-australischen Wurzeln jene heraus, die aus welchen Gründen auch immer der Ansicht sind, dass eine Welt ohne Nuklearwaffen mehr Sicherheit verspricht. In Leahs Bewertung ist die internationale Politik auf fundamentale Weise durch nukleare Abschreckung in den zwischenstaatlichen Beziehungen geprägt – eine strukturelle Gegebenheit, die weiterbestehen solle. Daraus macht die Autorin keinen Hehl. Für sie steht außer Frage, dass man sich schon etwas vormacht, wenn man nukleare Abrüstung als möglich erachtet. Das Buch bietet ein informiertes Gedankenspiel: Was wären die Konsequenzen für Politik und Militärstrategie, wenn es theoretisch gelänge, alle Atomwaffenarsenale vollständig abzubauen? Streicht man „nuklear“ aus nuklearer Abschreckung bliebe nur „Abschreckung“. Wie könnte diese funktionieren in einem post-nuklearen Zeitalter? Was würde nicht-nukleare Abschreckung für existierende US-Allianzen wie etwa die NATO bedeuten? Wie könnte Rüstungskontrollpolitik aussehen? Wie würde sich ein solch drastischer Wandel auf Krieg und Frieden auswirken?
Das Buch ist im Zuge von Forschungsaufenthalten am Massachusetts Institute of Technology und an der Yale University entstanden. Bestimmte Kapitel sind bereits in Fachzeitschriften erschienen. Immer wieder steht Ostasien im Schatten des Aufstiegs Chinas und des Nordkorea-Problems im Fokus. Leah bezieht eine direkte Gegenposition zu US-Präsident Obamas Global-Zero Rede und steht damit auch im Gegensatz zu den öffentlichkeitswirksamen Beiträgen der amerikanischen elder statesmen William J. Perry, George P. Shultz, Sam Nunn und Henry A. Kissinger. Diese Gang of Four hatte angemahnt, globale nukleare Abrüstung müsse betrieben werden. Leah hält das für eine sehr schlechte Idee. Nuklearwaffenpolitik solle nicht mit dem Abbau von Nuklearwaffen beschäftigt sein, sondern damit, die Welt sicherer zu machen – was nicht notwendigerweise auf das Gleiche hinausläuft (S. 8).
Abolitionisten, so die Verfasserin, seien unkritisch und zu optimistisch hinsichtlich der Strukturen der internationalen Politik. Die Annahme, dass durch Abschaffung einer Waffenkategorie die zwischenstaatlichen Beziehungen irgendwie harmonischer, stabiler und sicherer würden, sei weitgehend unrealistisch. Zurecht stellt Leah heraus, dass die Abrüstungsdiskussion häufig schwerpunktmäßig auf die USA bzw. den Westen abstelle. Die westlichen Länder sollten vorangehen, dann würden die anderen folgen. Die Idee, durch eigenes Abrüsten andere – z. B. Pakistan, Israel oder China – zum Abrüsten zu bewegen sei Wunschdenken. Fraglich sei auch, worauf sich „Null“ in einer atomwaffenfreien Welt im globalen Maßstab beziehen solle oder müsse: Kein Nuklearwaffenbesitz? Keine Waffensysteme, um Kernwaffen an Zielpunkte zu transportieren? Keine latente Fähigkeit von Staaten, wieder nuklear zu rüsten? Keine Technologie, die zur Herstellung von Nuklearrüstung geeignet sei? Kein Wissen darum, wie man nuklear rüstet? Hier deuten sich gewaltige Zweifel an effektiver nuklearer Abrüstungspolitik an. Zudem sei das strategische Denken (nicht nur) in der „westlichen Welt“ seit 1945 durch die Annahme des Fortbestehens nuklearer Waffen grundlegend strukturiert worden. Auf Abschreckung bezogene Konzepte wie „assured destruction“, „strategic stability“, „extended deterrence“, „escalation“ oder „escalation control“ seien „‘nuclear’ in nature“ (S. 43). Es erscheint für Leah schwierig bis unmöglich, diese Konzepte zu ‚denuklearisieren‘.
Originell ist ihre These, dass sich die historisch so bedeutsame Mobilisierungsdynamik – man denke nur an die Juli-Krise 1914 – aufgrund der Kombination aus interkontinentalen ballistischen Raketen und thermonuklearen Waffen fundamental verändert habe: „Im Zeitalter nuklearer Raketen sind Atomstreitkräfte ständig mobilisiert“ – nämlich 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Statt des destabilisierenden Drucks aufgrund situativer Streitkräftemobilisierung in der prä-nuklearen Ära herrsche persistent stabilisierender Druck aufgrund der permanenten Mobilisierung der wichtigsten militärischen Fähigkeiten vor. Und dieser Druck könnte nicht in gleichem Maße durch Raketen ohne nukleare Komponente generiert werden (S. 58 f.).
Hypothetisch und bestreitbar ist die pessimistische Einschätzung des Buches, wonach die erweiterte Abschreckung der USA zugunsten von Verbündeten in Ostasien keine zwei Jahrzehnte mehr überdauern mag (S. 86) oder in einer Krise kollabieren könnte (S. 162/168). Als ein struktureller Grund wird hier das zweifelsohne herausfordernde Logistikproblem im maritimen Kontext der Pazifikregion genannt. Überzeugender ist die These, dass ein nuklearer Abrüstungsprozess das Problem einer gefährlich instabilen Abhängigkeit von fragilen konventionellen Gleichgewichten bewirken würde. Hieraus leitet die Autorin die klassische Empfehlung ab, Rüstungskontrolle zuvörderst an ihren Wirkungen auf strategische Stabilität zu bemessen. Kühn, wenn nicht allzu pikant, setzt sie hinzu, dass das immer wieder diplomatisch beschworene Ziel, auf allgemeine und vollständige Abrüstung hinwirken zu wollen, nie ernst genommen worden sei (S. 136).
Abschließend fragt Leah: Soll der „nukleare Friede“ wirklich „entwaffnet“ werden? Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Aufgaben einer strategischen Politik bei einer erfolgreichen Eliminierung von Kernwaffen nicht wegfallen würden, sondern vermutlich schwieriger zu bewältigen wären als es heute schon der Fall ist (S. 150). Die Autorin geht noch deutlich weiter in einer Passage (S. 159–171), die insbesondere angesichts aktueller Problemlagen hochbrisant ist. Kess trägt Leah ihre – sprachlich nicht völlig eindeutige, aber sinngemäß erkennbare – Empfehlung vor, die USA sollten ihr nationales Interesse darin sehen, den „nuklearen Frieden“ zu stärken und ihre eigenen Lasten zu reduzieren, indem Washington den Verbündeten in Ostasien – Japan, Südkorea und Australien – zur eigenen Nuklearbewaffnung rät (S. 160). Leah lässt offen, wie der Prozess zu gestalten wäre, welches Ziel dabei verfolgt werden und wie die Sicherheitsordnung letztlich aussehen sollte. Es erscheint so, als sollten die USA initiativ oder proaktiv tätig werden. Dass hierdurch das internationale Nichtverbreitungsregime demoliert oder zerstört würde, erscheint bei ihr als hinnehmbarer Nebeneffekt angesichts wichtigerer Probleme. Die USA sollten also ihre Präferenzen radikal ändern, meint Leah. Abrüstungsbefürwortern, dem Status quo verpflichteten Experten aber auch anderen intellektuellen Vertretern im Forschungsbereich internationale Beziehungen mag diese Empfehlung als indiskutabel und nicht hilfreich erscheinen. Aber ein nüchterner Umgang mit dem Thema ist angemessen. Leahs Ansatz ist nicht neu. Sie bezieht sich etwa auf Kenneth N. Waltz, den großen Neorealisten. Auch stützen die von Leah genannten Länder ihre Sicherheit längst auf nukleare Abschreckung. Im Vergleich dazu bleibt der Stellenwert von Kernwaffenkontrolle bei ihr gering.
Leahs Empfehlung mag als wenig realistisches Wunschdenken der anderen Art erscheinen, dessen analytische und normative Prämissen viele nicht ohne weiteres teilen werden (den Rezensenten eingeschlossen). Und doch geht man wohl nicht in die Irre mit einem „Erwartungshorizont“ (Reinhart Koselleck) für das 21. Jahrhundert, wonach nukleare Proliferation viel wahrscheinlicher ist als eine Welt ohne Nuklearwaffen. Ob das Interesse z. B. in Japan an nationaler Nuklearbewaffnung strukturell so groß ist (oder so groß wird) wie die Autorin insinuiert und ob dort eine Nuklearbewaffnung als ein Gewinn bewertet wird, der die enormen Risiken und Kosten eines solchen radikalen Politikwechsels in Tokio rechtfertigen würde, ist nicht selbsterklärend. Und hier ist die Geschichte wohl kein sicherer Ratgeber, wenn auch ein starker Indikator. Leah weist auf neue historische Forschungen zum Fall Japan etwa in den 1960er Jahren hin, die manchen überraschen werden, weil angerissen wird, in welchem Maße Überlegungen über eine japanische Nuklearbewaffnung eine Rolle gespielt hatten (S. 160 ff.). Speziell die US-Regierung Trump muss erst noch zeigen, dass ihre Politik in der Kontinuität der US-Nichtverbreitungspolitik seit 1945 steht. Als sicher kann dies nicht gelten. Trump selbst ist im Wahljahr 2016 mit ambivalenten Äußerungen hervorgetreten, in denen er überraschend dezidiert für alliierte nukleare Proliferation Stellung bezogen hatte. Und Leah zitiert den amtierenden US Deputy Assistant Secretary of Defense for Strategy and Force Development, Elbridge A. Colby. Dieser hatte vor seiner Amtszeit in der Nichtverbreitungsdebatte der analytischen community in den USA den Standpunkt vertreten, dass Amerika auch bei einem Versuch eines nicht-nuklearen US-Verbündeten, Nuklearmacht zu werden, NV-Politik nicht als „summum bonum“ der US-Politik missverstehen, sondern sein geopolitisches Allianzinteresse priorisieren solle (S. 169). Leah geht jedoch einen Schritt weiter als Colby und dieser Schritt erscheint gewaltig zu sein. Colby schien nämlich über einen Prioritätenkonflikt in einem hypothetischen und seitens der US-Regierung nicht (oder nicht ohne weiteres) angestrebten Fall nachzudenken, den herbeizuführen Leah den USA gerade empfiehlt.
Leah hat ein in vielerlei Hinsicht anregendes und immer wieder offen herausforderndes Buch vorgelegt, dessen Hauptargumente zu einer rigoroseren Diskussion über Erfolgsbedingungen und Implikationen nuklearer Abrüstung anregen sollten – und dies auch in Deutschland.
© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Articles in the same Issue
- Cover und Titelseiten
- Cover und Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die Rolle von Abschreckung im neuen strategischen Umfeld Europas
- Die Dynamik der Abschreckung
- Abschreckung einst und heute
- Erweiterte Abschreckung in Asien: aktuelle Lehren für Europa
- Berichte und Kurzdarstellungen
- Die Trump-Präsidentschaft – Jahr 2
- Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump Administration
- Russische Marinedoktrin und maritime Rüstung: Anspruch und Realität
- Ergebnisse internationaler strategischer Analysen
- John Allen/ Philip M. Breedlove/ Julian Lindley-French/ George Zambellas: Future War NATO. From Hybrid War to Hyper War via Cyber War. 2017.
- Karl-Heinz Kamp/ Wolf Langheld: The Military Adaptation of the Alliance. 2017.
- Ian J. Brzezinski/ Tomáš Valášek: Reanimating NATO's Warfighting Mindset: Eight Steps to Increase the Alliance's Political-Military Agility. 2017
- Ted Piccone: Democracy and Cybersecurity. Brookings – Democracy and Security Dialogue Policy Brief Series. 2017
- Sarah Fainberg: Russian Spetsnaz, Contractors and Volunteers in the Syrian Conflict, Institut français des relations internationales (IFRI), Russie, Nei. 2017. Tom Parfitt: President Putin's Private Army Pays a High Price for Syria Success. 2017.
- Benjamin Herscovitch: A Balanced Threat Assessment of China's South China Sea Policy. 2017.
- Kroenig, Matthew/ Oh, Miyeon. A Strategy for the Trans-Pacific Century: Final Report of the Atlantic Council's Asia-Pacific Strategy Task Force. 2017.
- United Nations Office on Drugs and Crime: World Drug Report 2017. 2017.
- Tom Keatinge, Anne-Marie Barry: Disrupting Human Trafficking: The Role of Financial Institutions. 2017.
- Buchbesprechungen
- Brad Roberts: The Case for U.S. Nuclear Weapons in the 21st Century. 2016.
- Christine M. Leah, The Consequences of American Nuclear Disarmament. Strategy and Nuclear Weapons. 2017.
- Paul Cornish, Kingsley Donaldson: 2020. World of War. 2017.
- Christopher Coker, Rebooting Clausewitz. On War in the 21st Century. 2017.
- MichaelPaul, „Kriegsgefahr im Pazifik? Die maritime Bedeutung der sino-amerikanischen Rivalität“. 2017.
- Translated Articles (e-only)
- The Role of Deterrence in a new European strategic environment
- Deterrence Then and Now.
Articles in the same Issue
- Cover und Titelseiten
- Cover und Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die Rolle von Abschreckung im neuen strategischen Umfeld Europas
- Die Dynamik der Abschreckung
- Abschreckung einst und heute
- Erweiterte Abschreckung in Asien: aktuelle Lehren für Europa
- Berichte und Kurzdarstellungen
- Die Trump-Präsidentschaft – Jahr 2
- Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump Administration
- Russische Marinedoktrin und maritime Rüstung: Anspruch und Realität
- Ergebnisse internationaler strategischer Analysen
- John Allen/ Philip M. Breedlove/ Julian Lindley-French/ George Zambellas: Future War NATO. From Hybrid War to Hyper War via Cyber War. 2017.
- Karl-Heinz Kamp/ Wolf Langheld: The Military Adaptation of the Alliance. 2017.
- Ian J. Brzezinski/ Tomáš Valášek: Reanimating NATO's Warfighting Mindset: Eight Steps to Increase the Alliance's Political-Military Agility. 2017
- Ted Piccone: Democracy and Cybersecurity. Brookings – Democracy and Security Dialogue Policy Brief Series. 2017
- Sarah Fainberg: Russian Spetsnaz, Contractors and Volunteers in the Syrian Conflict, Institut français des relations internationales (IFRI), Russie, Nei. 2017. Tom Parfitt: President Putin's Private Army Pays a High Price for Syria Success. 2017.
- Benjamin Herscovitch: A Balanced Threat Assessment of China's South China Sea Policy. 2017.
- Kroenig, Matthew/ Oh, Miyeon. A Strategy for the Trans-Pacific Century: Final Report of the Atlantic Council's Asia-Pacific Strategy Task Force. 2017.
- United Nations Office on Drugs and Crime: World Drug Report 2017. 2017.
- Tom Keatinge, Anne-Marie Barry: Disrupting Human Trafficking: The Role of Financial Institutions. 2017.
- Buchbesprechungen
- Brad Roberts: The Case for U.S. Nuclear Weapons in the 21st Century. 2016.
- Christine M. Leah, The Consequences of American Nuclear Disarmament. Strategy and Nuclear Weapons. 2017.
- Paul Cornish, Kingsley Donaldson: 2020. World of War. 2017.
- Christopher Coker, Rebooting Clausewitz. On War in the 21st Century. 2017.
- MichaelPaul, „Kriegsgefahr im Pazifik? Die maritime Bedeutung der sino-amerikanischen Rivalität“. 2017.
- Translated Articles (e-only)
- The Role of Deterrence in a new European strategic environment
- Deterrence Then and Now.

