Reviewed Publication:
von Fritsch Rüdiger Zeitenwende Putins Krieg und die Folgen. 1. Auflage Berlin Aufbau Verlage 1 176 2022
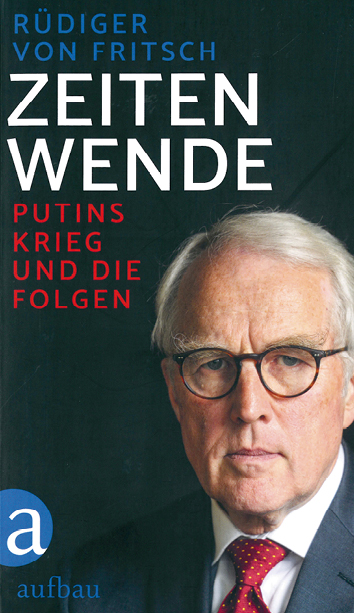
Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, ist dem deutschen Publikum durch Beiträge in Funk und Fernsehen bekannt. Sein 2020 erschienenes Buch Russlands Weg. Als Botschafter in Moskau erlangte Bestseller-Status. Auf dem deutschen Buchmarkt zu Russland sticht es durch eine fundierte, sachlich differenzierte und erfahrungsgesättigte Darstellung der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland hervor. Nun hat von Fritsch ein weiteres Werk mit dem Titel Zeitenwende. Putins Krieg und die Folgen vorgelegt. Bei Büchern, die mit heißer Feder am Anfang eines Kriegs geschrieben wurden und die im Titel bereits mit dessen Folgen werben, ist eine gewisse Skepsis angebracht. Zu schnell können sich die Ereignisse in eine ungeahnte Richtung entwickeln oder Einschätzungen überholt sein. Auf diese grundsätzliche Problematik weist der Autor eingangs auch hin. Der Informationsstand des Buchs endet Mitte April 2022; also etwa anderthalb Monate nach Kriegsbeginn. Der Schwerpunkt der vier Kapitel des Buchs liegt demzufolge auf der Vorgeschichte des Krieges und den Entwicklungen Russlands unter Putin. Und genau diese Schwerpunktsetzung ist im Lichte aktueller Debatten um Kriegsverursacher und Opfer, die hierzulande nicht selten durcheinandergebracht oder (teils vorsätzlich) vertauscht werden, wichtig und richtig, weil sie nochmals den Blick für die wesentlichen Entwicklungen bis zum 24. Februar 2022 schärft.
Wie jeder Krieg hat auch dieser eine lange Vorgeschichte und wie in jedem politischen Konflikt ringen verschiedene Sichtweisen um Dominanz und Glaubhaftigkeit. Oftmals geht dabei der Blick auf die Faktenlage verloren oder wird überlagert von Vorurteilen, Meinungen, Halbwahrheiten oder Desinformation. Von Fritsch gelingt es überzeugend, auf wenigen Seiten die wesentlichen Ereignisse und Etappen darzustellen, einzuordnen und dabei stets die unmittelbaren und möglichen Folgen mit zu bedenken. Dieser nüchterne (wenngleich nicht wertfreie) und gut lesbare Stil ist in einer Zeit aufgeregter Debatten und beinahe täglicher Strategie- und Kriegsfolgen-Diskussionen wohltuend. Seine Ausführungen zum System Putin und dessen antiwestliche Weltbilder und Narrative in Kapitel 2 (Der Schatten der Geschichte) sind für Russland- und Osteuropakenner keine Neuigkeit. Sie adressieren eher ein breiteres Lesepublikum und schaffen Verständnis für das politisch-weltanschauliche Denken im Kreml und in der russischen Elite. Das aktuell wichtigste Kapitel ist aus Sicht des Rezensenten indes Kapitel 3 (Der Weg in den Krieg), weil es die wichtigsten Etappen, Entscheidungen und Reaktionen Russlands und der westlichen Staaten auf knapp sechzig Seiten zusammenträgt. Von Fritsch beginnt hier mit dem Schlüsseljahr 2014 und endet mit der diplomatischen und später militärischen Eskalation im Februar 2022. Aus heutiger Sicht sollten insbesondere zwei Aspekte ins Gedächtnis gerufen werden, die womöglich übersehen oder bereits vergessen wurden. Zum einen Moskaus Forderungskatalog vom 17. Dezember 2021 an die USA und die NATO, der im Grunde unerfüllbare Forderungen hinsichtlich der Sicherheitsarchitektur (Ost-)Europas enthielt. Ein Faktum, dessen sich der Kreml eigentlich hätte bewusst sein müssen (und vielleicht auch war). Und zweitens die Aussagen hoher russischer Funktionäre, die von Fritsch zitiert: „Die russische Seite wurde nicht müde zu betonen, dass sie keinerlei Angriffsabsichten hege. Nikolai Patruschew, einer der engsten Weggefährten Wladimir Putins, früherer Geheimdienstchef und heute Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, stellte Ende Januar kategorisch fest: ‚Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen ihn überhaupt nicht.‘ Behauptungen, Russland bedrohe die Ukraine, seien ‚eine komplette Absurdität, es gibt keine Bedrohung.‘ Der Westen verbreite ‚eigennützige Erfindungen‘, um Russland zu schaden“ (S. 116). Das ist das alte Kreml-Narrativ vom Westen als ewigem Feind Russlands. Zynisch gesprochen hat Patruschew in einer Sache recht: Russland will tatsächlich keinen Krieg, weil es eine Sonderoperation führt. Den Krieg (voina) gibt es in Russland diskursiv und medial nicht, faktisch allerdings schon.
Die Kapitel, die künftig bedeutsam werden – strategisch wie retrospektiv –, sind Kapitel 1 (Wie der Krieg enden könnte) und Kapitel 4 (Die Folgen des Krieges). Von Fritsch skizziert vier Szenarien, die er in gebotener Kürze entfaltet: ein Sieg der Ukraine, ein Sieg Russlands, ein Patt und eine Eskalation des Konflikts (S. 20–29). Es ist müßig zu sinnieren, welches dieser vier Szenarien gegenwärtig das plausiblere oder wahrscheinlichere ist – die Zeit wird es zeigen. Unmittelbar von Bedeutung sind vielmehr die Möglichkeiten der deutschen (und westlichen) Politik, auf den Konfliktverlauf Einfluss zu nehmen und die Grundlagen der künftigen Beziehungen mit Russland zu legen. Von den vielen Politikparadigmen, die der Krieg bereits beerdigt hatte (so z. B. „Wandel durch Handel“) zählt nun auch die über Jahre gepredigte Formel von der Sicherheit Europas, die nicht gegen, sondern nur mit Russland zu erreichen sei. Diese Sicht erachtet auch von Fritsch als überholt: „Sicherheit mit Russland ist gegenwärtig nicht länger denkbar, die von Wladimir Putin gewählte Konfrontation verlangt Entschlossenheit, Festigkeit im Bündnis und Bereitschaft zur Abschreckung. Für mich, der ich 35 Jahre lang im Auswärtigen Dienst unsere Politik aus Überzeugung vertreten habe, ist diese fundamentale Neuausrichtung konsequent“ (S. 141). Er plädiert zu Recht, auch künftig die russische Sicht stets im Blick zu behalten. Nur dürfe man den russischen Befindlichkeiten nicht auf den Leim gehen und sich diesen vorauseilend anpassen: „In Russland geht es immer nur um die eigene Befindlichkeit, nicht die der Menschen des Baltikums oder der anderen Völker in Ostmitteleuropa, die unter sowjetischer Okkupation oder Fremdbestimmung ein teils furchtbares Schicksal erlitten haben“ (S. 51). Und weiter: „Mit der Fixierung auf das eigene Leid und den Verlust ging und geht die Erwartung einher, dass es die Sache der anderen sei, russischen Befindlichkeiten und Ansprüchen Rechnung zu tragen und Umstände zu schaffen, die Russland genehm sind“ (ebd.). Mit dieser Feststellung trifft von Fritsch ins Schwarze. Sie ist nicht nur in (Ost-)Deutschland weitverbreitet, sondern auch bei unserem französischen Nachbarn (Macrons „gesichtswahrende Lösungen“). Eine wirkliche sicherheits- und russlandpolitische Zeitenwende beginnt mit einer realistischen Sicht der eigenen Rolle und Ziele. Daher ist die Ausbildung strategischer Fähigkeiten so wichtig, die jedoch im deutschen Kontext – bedingt durch die europäische Integration – nicht so einfach realisierbar ist wie bei den Großmächten. Auf dieses Dilemma macht von Fritsch aufmerksam: „Außen- und Sicherheitspolitik ist ein Herzstück der Souveränität eines jeden Mitgliedstaates. Doch ohne eine aktive, strategisch ausgerichtete Außen- und Sicherheitspolitik wird Europa nicht bestehen können, dies hat uns das Handeln Wladimir Putins gelehrt, welches uns noch vor Kurzem unvorstellbar schien“ (S. 148). Er ist nicht der einzige, der auf die Gefahr einer drohenden europäischen Bedeutungslosigkeit hinweist. Auch er bietet keinen goldenen Ausweg aus diesem Zustand an, aber im Umgang mit Russland zeigt er gedankliche und strategische Wege auf, die bedenkenswert sind. Zum einen plädiert er für eine „geordnete Konfrontation“ (S. 141), innerhalb derer Verabredungen über die Begrenzung von Waffensystemen möglich seien, um wieder mehr Berechenbarkeit herstellen zu können. Doch dazu gehören bekanntlich zwei und die Grundbedingung, dass beide über dasselbe reden und sich verstehen (wollen), darf auf russischer Seite derzeit bezweifelt werden. Zum anderen macht von Fritsch am Ende des Buchs klar, was Putin wirklich fürchtet und was alles in Bewegung geraten könnte, wenn er nicht mehr der starke Mann im Kreml wäre. „Nichts dürfte Wladimir Putin mehr fürchten als einen russischen Lech Wałęsa, einen charismatischen Anführer, ‚den noch niemand kennt, auch der Geheimdienst nicht‘“ (S. 169). Aber das, so schickt von Fritsch hinterher, wäre nicht das Ende der Auseinandersetzung mit Russland. Die Kontinuitäten russischer Außenpolitik können das Land auf dem Pfad neoimperialer Großmachtpolitik halten: „Würde eine vom Militär geprägte Herrschaft in Moskau eine Neuausrichtung der russischen Außenpolitik bedeuten? Davon ist nicht auszugehen. […] Ganz gleich, ob es Wladimir Putin gelingt, sich an der Macht zu halten, oder ob es zu einem Umbruch kommt: Wir sind gut beraten, uns darauf einzustellen, dass sich in Russland einstweilen nicht allzu viel ändern dürfte“ (S. 172–173). Rüdiger von Fritsch bietet wenig Optimistisches, dafür eine fundierte Analyse und die langjährige Erfahrung eines deutschen Spitzenbeamten des Auswärtigen Amts und des Bundenachrichtendienstes. Dem Buch ist eine breite Leserschaft zu wünschen, weil es zeigt, wie es zu diesem Krieg gekommen ist und weil es auf die Konflikte vorbereitet, die noch kommen könnten. Eine Schwäche des Buchs ist allerdings das fehlende Quellen- und Literaturverzeichnis.
About the author
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand der Politikwissenschaft
© 2022 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Russland-Politik in der Ära Merkel
- Strategische Irrtümer, Fehler und Fehlannahmen der deutschen Energiepolitik seit 2002
- Strategische Irrtümer deutscher Außenpolitik im Rückblick – die Jahre von 1890 bis 1914
- Alles schon mal dagewesen? Der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine in historischer Perspektive
- Das Schwert, der Schild und der Igel – Die Stärkung der Abschreckung im Rahmen des neuen Strategischen Konzepts der NATO
- Kurzanalyse
- Die strategische Bedeutung von Belarus im Ukraine-Krieg – interne und externe Entwicklungen
- Besprechungen strategischer Analysen
- Ukraine-Krieg
- Jeffrey Mankoff: Russia’s War in Ukraine. Identity, History and Conflict. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), April 2022,
- Jack Watling/Nick Reynolds: Ukraine at War. Paving the Road from Survival to Victory. London: Royal United Services Institute (RUSI), Juli 2022
- James Byrne/Gary Somerville/Joseph Byrne/Jack Watling/Nick Reynolds/Jane Baker: Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia’s War Machine. London: Royal United Services Institute (RUSI), August 2022
- Bryan Frederick/Samuel Charap/Scott Boston/Stephen J. Flanagan/Michael J. Mazarr/Jennifer D. P. Moroney/Karl P. Mueller: Pathways to Russian Escalation Against NATO from the Ukraine War. RAND Corporation, Juli 2022.
- Jeffrey A. Sonnenfeld/Steven Tian/Franek Sokolowski/Michal Wyrebkowski/Mateusz Kasprowicz: Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy. Measures of Current Economic Activity and Economic Outlook Point to Devastating Impact on Russia. New Haven: Yale University, Juli 2022
- Europa und China
- Ian Bond/François Godement/Hanns W. Maull/Volker Stanzel: Rebooting Europe’s China Strategy. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2022
- Bücher von gestern – heute gelesen
- Karen Dawisha: Putin´s Kleptocracy. Who owns Russia? New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi: Simon & Schuster 2014, 464 Seiten
- Buchbesprechungen
- Rüdiger von Fritsch: Zeitenwende. Putins Krieg und die Folgen. 1. Auflage. Berlin: Aufbau Verlage 2022, 176 Seiten
- Gert R. Polli: Schattenwelten. Österreichs Geheimdienstchef erzählt. 1. Auflage. Graz: Ares Verlag 2022, 320 Seiten
- Ashley J. Tellis: Striking Asymmetries. Nuclear Transitions in South East Asia. Washington, D.C.: Carnegie Endowment 2022, 318 Seiten
- Bildnachweise
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Russland-Politik in der Ära Merkel
- Strategische Irrtümer, Fehler und Fehlannahmen der deutschen Energiepolitik seit 2002
- Strategische Irrtümer deutscher Außenpolitik im Rückblick – die Jahre von 1890 bis 1914
- Alles schon mal dagewesen? Der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine in historischer Perspektive
- Das Schwert, der Schild und der Igel – Die Stärkung der Abschreckung im Rahmen des neuen Strategischen Konzepts der NATO
- Kurzanalyse
- Die strategische Bedeutung von Belarus im Ukraine-Krieg – interne und externe Entwicklungen
- Besprechungen strategischer Analysen
- Ukraine-Krieg
- Jeffrey Mankoff: Russia’s War in Ukraine. Identity, History and Conflict. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), April 2022,
- Jack Watling/Nick Reynolds: Ukraine at War. Paving the Road from Survival to Victory. London: Royal United Services Institute (RUSI), Juli 2022
- James Byrne/Gary Somerville/Joseph Byrne/Jack Watling/Nick Reynolds/Jane Baker: Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia’s War Machine. London: Royal United Services Institute (RUSI), August 2022
- Bryan Frederick/Samuel Charap/Scott Boston/Stephen J. Flanagan/Michael J. Mazarr/Jennifer D. P. Moroney/Karl P. Mueller: Pathways to Russian Escalation Against NATO from the Ukraine War. RAND Corporation, Juli 2022.
- Jeffrey A. Sonnenfeld/Steven Tian/Franek Sokolowski/Michal Wyrebkowski/Mateusz Kasprowicz: Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy. Measures of Current Economic Activity and Economic Outlook Point to Devastating Impact on Russia. New Haven: Yale University, Juli 2022
- Europa und China
- Ian Bond/François Godement/Hanns W. Maull/Volker Stanzel: Rebooting Europe’s China Strategy. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2022
- Bücher von gestern – heute gelesen
- Karen Dawisha: Putin´s Kleptocracy. Who owns Russia? New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi: Simon & Schuster 2014, 464 Seiten
- Buchbesprechungen
- Rüdiger von Fritsch: Zeitenwende. Putins Krieg und die Folgen. 1. Auflage. Berlin: Aufbau Verlage 2022, 176 Seiten
- Gert R. Polli: Schattenwelten. Österreichs Geheimdienstchef erzählt. 1. Auflage. Graz: Ares Verlag 2022, 320 Seiten
- Ashley J. Tellis: Striking Asymmetries. Nuclear Transitions in South East Asia. Washington, D.C.: Carnegie Endowment 2022, 318 Seiten
- Bildnachweise

