Reviewed Publication:
Fröhlich Stefan Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung Wiesbaden Springer Verlag 2019 1 166
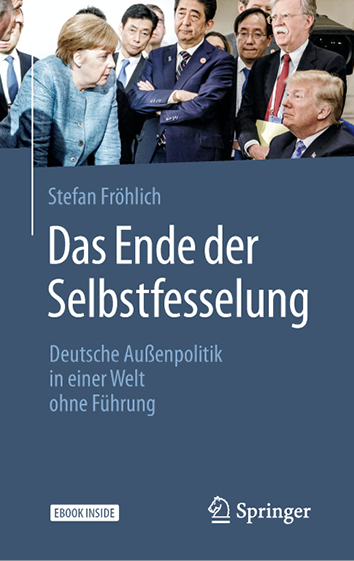
Ist ein Glas halbleer oder halbvoll? Sieht man eher das Gute oder das Schlechte? Stefan Fröhlich entscheidet sich für das halbvolle Glas, wenn er auf die Außenpolitik Deutschlands im 21. Jahrhundert blickt. In einer umfassenden Bestandsaufnahme der deutschen Außenpolitik „in einer Welt ohne Führung“ gelingt Fröhlich ein lesenswertes Buch. Er nimmt zwar eine durchaus kritische Analyse vor, ohne jedoch dabei in jenen Pessimismus und Skeptizismus zu verfallen, der des Öfteren im Diskurs um Deutschlands Außenpolitik zu vernehmen ist.
Ausgangspunkt des Buches ist die Feststellung, dass Deutschland „wahlweise hochgelobt und kleingeredet, bewundert und kritisiert [wird], vielen ist es zugleich zu stark und zu schwach“ (S. 1). Deutschlands politische Stärke werde von vielen Beobachtern nach wie vor mehr als Risiko denn als Chance für Europa gesehen. Damit einhergehend werde noch immer der Vorwurf erhoben, dass Deutschland auf internationaler Ebene ein Trittbrettfahrer sei und sich globaler Verantwortung entziehe. Dem setzt Fröhlich das Ergebnis seiner Analyse entgegen, wonach Deutschland einen neuen Pragmatismus in der Bewältigung der zentralen europäischen und globalen Herausforderungen auszeichne. Deutschland ist seit 2010 zur zentralen Macht in Europa aufgestiegen und hat in großen Krisen (mit Ausnahme der Flüchtlingskrise) nie im Alleingang gehandelt und immer Verantwortung übernommen sowie seinen Beitrag zur Lösung beigetragen. Für den Autor ist die Debatte über Deutschlands eigentümliche Rolle zwischen Selbstbeschränkung und Hegemonie in Europa und der Welt „schlichtweg überholt“ (S. 3). Fröhlich macht mit seinem Buch ein starkes Argument, wonach „die deutsche Außenpolitik besser als ihr Ruf ist und dass dieses Land, anders als es die stereotypen Kritiken aus dem In- und Ausland suggerieren, längst in der politischen Realität des 21. Jahrhunderts angekommen ist“ (S. 4). Dabei war Deutschlands Pragmatismus in den vergangenen Jahren „durchaus die passende Antwort auf die Herausforderungen in Europa und in der Welt“ (S. 4).
Fröhlich unternimmt in insgesamt fünf Kapiteln einen profunden und intensiven Streifzug durch die Themen und Herausforderungen der Außenpolitik Deutschlands. Zunächst erläutert er in Kapitel 1 Deutschlands Rolle in der Welt und die Entwicklung der deutschen Außenpolitik. Deutschland stehe „vor Herausforderungen, die es zunehmend entschlossener und flexibler angeht als in der Vergangenheit und bei denen es bereit ist, seine Positionen und Präferenzen zu behaupten, gleichzeitig aber auch Kompromisse einzugehen oder Korrekturen vorzunehmen.“ (S. 29) Diese Herausforderungen führt Fröhlich in den folgenden drei Kapiteln näher aus.
In Kapitel 2 behandelt Fröhlich die Zukunft der Weltwirtschaft und des Euroraums und zeichnet hier detailliert den Einfluss Deutschlands nach. Beispielsweise wird dargelegt, dass während der Eurokrise Deutschlands Politik der Konditionalität durchaus aus einem Gefühl der eigenen Stärke als zentrale Wirtschaftsmacht Europas in Europa erfolgte. Aus dieser Stärkeposition hat Deutschland seine ordnungspolitischen Vorstellungen und Interessen weitgehend durchgesetzt. Der Pragmatismus im deutschen Handeln zeige sich jedoch darin, dass Berlin aber auch zu schmerzhaften Kompromissen bereit war, um den Zusammenbruch der Währungsunion nicht zu riskieren.
Deutschlands Position der Stärke und seine Durchsetzungsfähigkeit im Wirtschafts- und Finanzbereich kontrastiert stark mit Deutschlands Rolle im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auf die Fröhlich in Kapitel 3 intensiv eingeht. Hier diagnostiziert auch er eine „Erwartungslücke“, betont aber auch, dass Deutschland immer mehr zur Übernahme von mehr Verantwortung in Form konkreter sicherheitspolitischer Beiträge bereit ist. Sei es im Kontext der Ukraine-Krise, dem stärkeren Engagement in der südlichen Peripherie Europas oder bei der schrittweisen Anhebung des Verteidigungsetats. Dabei sieht Fröhlich das Militär nicht als alleinigen Lösungsansatz, sondern plädiert dafür, dass Deutschland sein „beachtliches Machtportfolio“ einsetzt, um eine stärkere Rolle in der Bearbeitung und Lösung der vielgestaltigen Probleme Europas einzunehmen. Fröhlich zeigt auf, dass Deutschland „als vollentwickelte europäische Macht angekommen“ (S. 103) ist. Für ihn sind Bedenken gegenüber einem militärisch stärkeren und sicherheitspolitisch selbstbewussteren Deutschland gegenstandslos, da die jüngste Vergangenheit zeigt, dass Deutschland seine Fähigkeiten konsequent im Rahmen der Europäischen Union und der NATO einsetzt.
Im vierten Kapitel richtet Fröhlich dann den Blick auf die globale Ebene und thematisiert die transatlantische und andere strategische Partnerschaften Deutschlands. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist dabei für Fröhlich „die wohl größte unmittelbare politische Herausforderung, auf die das Land reagieren muss“ (S. 105). Mit Trump wird die schon länger stattfindende Abwendung der USA von Europa nur offensichtlich und verdeutliche den Handlungsbedarf für Deutschland und Europa. Fröhlich sieht in dieser Herausforderung aber auch eine Chance, denn Trump könnte „zum entscheidenden Katalysator für die Schaffung einer glaubwürdigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden, in der Deutschland neben Frankreich der zentrale Pfeiler ist“ (S. 106). Denn was auch über Trump hinaus bleiben wird, ist die Forderung der USA an die Europäer (und speziell an Deutschland) nach einer stärkeren Lastenteilung. Sollte das transatlantische Verhältnis endgültig zerbrechen, so stünde Europa alleine da und müsste selbst für seine Sicherheit in seiner südlichen Peripherie aber auch gegenüber Russland sorgen – eine Aufgabe, die die Europäer aktuell nicht bewerkstelligen könnten. Fröhlich plädiert dafür, dass Europa sich neben den USA und China als drittes großes Kraftzentrum in einer multipolaren Welt positionieren soll. Auch hier verspricht ein pragmatischer Umgang sowohl mit den USA, als auch einem revisionistischen Russland sowie einem immer dominanteren China den besten außenpolitischen Ansatz.
Im abschließenden Kapitel 5 fasst Fröhlich seine Ausführungen zusammen. Er rät Deutschland, weiterhin auf den als „Ambivalenzkompetenz“ betitelten Politikansatz zu setzen, den er wie folgt definiert: „die notwendige Fähigkeit im Zeitalter der Rückkehr der Realpolitik, an normativen Ansprüchen festzuhalten, gleichzeitig aber den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen und jede Möglichkeit der Kooperation zu nutzen“ (S. 151). Diese Widersprüchlichkeit kennzeichnet für ihn „Berlins neuen Pragmatismus auch im Umgang mit der Türkei, Russland, China oder Saudi-Arabien auf globaler Ebene. Dabei treten normative Ambitionen zunehmend hinter pragmatische, interessengeleitete Motive und die Bereitschaft zurück, trotz aller institutioneller Beschränkung Führung in Europa zu nehmen“ (S. 151). Mit dem Verweis, dass das Zivilmachtkonzept kein sinnvoller Analyseansatz für deutsche Außenpolitik mehr sei, macht Fröhlich deutlich, dass sich aus seiner Perspektive eine Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik vollzogen hat. In einer Welt, in der Macht auf globaler Ebene nicht partnerschaftlich und kooperativ gedacht wird, ist ein pragmatisches Verständnis bezüglich der eigenen Interessen und Handlungsmöglichkeiten essenziell.
Für Fröhlich hat Deutschland die Debatte zwischen Selbstbeschränkung und Hegemonie in Europa und der Welt sowie den Zustand der Lethargie und Passivität längst hinter sich gelassen. Fröhlich appelliert: „Ob das Land will oder nicht, es muss den eingeschlagenen Weg fortsetzen und fallweise Moral und Interessen gegeneinander abwägen. Das bedeutet nichts anderes, als einen realistischen Blick auf die Welt ertragen, das hinzunehmen, was man nicht ändern kann“ (S. 165).
Man merkt dem Buch an, dass es Fröhlich ein Anliegen war, seine positive Perspektive auf Deutschlands Außenpolitik in den Diskurs einzubringen und damit der Debatte gewissermaßen einen Neustart zu ermöglichen. Insgesamt verdeutlicht Fröhlich mit seinem Buch, dass es sich lohnt einen unvoreingenommenen und nüchternen Blick auf Deutschlands Außenpolitik einzunehmen. Dabei sollte man sich von der Vorstellung lösen, dass Deutschland in einen großen Wurf und Alleingang die Politik auf europäischer und globaler Ebene prägen möchte oder kann. Auch wenn dies genau die Anspruchshaltung von vielen Seiten ist (sowohl innerstaatlich als auch von internationalen Partnern), hat Deutschland mit einem pragmatischen Ansatz, der sich an den Realitäten im jeweiligen Politikfeld sowie an den eigenen Interessen und Möglichkeiten orientiert, sich aber auch an den europäischen Partnern ausrichtet, in den vergangenen Jahren durchaus erfolgreich Außenpolitik betrieben.
Kritisch sei anzumerken, dass Fröhlich zwar die Herausforderungen der Klimakrise an einigen Stellen im Buch erwähnt, doch dieser Politikbereich und dessen potentielle Folgewirkungen für die deutsche Außenpolitik und die internationale Ordnung zu wenig berücksichtigt wird. Der Klimawandel ist auch jenseits der global governance-Ansätze innerhalb der UN-Klimaverhandlungsprozesse ein Betätigungsfeld für deutsche und europäische Außenpolitik. Hier müssen Deutschland und Europa mit dem von Fröhlich nachgezeichneten Pragmatismus global eine stärkere Rolle spielen, wenn die Internationale Ordnung, von der Deutschland ganz besonders profitiert, erhalten werden soll.
© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die internationale Ordnung: Bestandsaufnahme und Ausblick
- Wie das Unmögliche möglich wurde – Die erfolgreiche Schaffung einer funktionierenden internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg
- Doppelte Wendezeit
- Den Westen neu denken. Wege aus der Krise der freien Welt
- Kurzanalysen und Berichte
- Der INF-Vertrag im Epochenwandel
- Brauchen wir einen Europäischen Sicherheitsrat?
- Ergebnisse internationaler strategischer Studie
- Internationaler Systemwandel
- Kristi Raik/Mika Aaltola/Jyrki Kallio/Katri Pynnöniemi: The Security Strategies of the US, China, Russia and the EU. Living in Different Worlds, Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, Juni 2018
- Peter Rudolf: Der amerikanisch-chinesische Weltkonflikt. Berlin: SWP, Oktober 2019.
- Bobo Lo: Greater Eurasia: The Emperor’s New Clothes or the Idea whose Time Has Come? Paris: Institut français des relations internationales (Ifri), Études de l’Ifri, Russie.Nei.Reports, No. 2, Juli 2019.
- Paul Dibb: How the geopolitical partnership between China and Russia threatens the West. Canberra: ASPI, November 2019
- Cheol Hee Park: Strategic Estrangement between South Korea and Japan as Barrier to Trilateral Cooperation. Washington, D.C.: Atlantic Council, 2019.
- Rüstungskontrolle und regionale Ordnung in Europa
- Samuel Charap/Jeremy Shapiro/Alexandra Dienes/Sergey Afontsev/Péter Balás/Rodica Crudu/James Dobbins/Vasyl Filipchuk/Diana Galoyan/Ulrich Kühn/Andrei Popov/Yauheni Preiherman/Pernille Rieker/Nikolai Silaev/Olesya Vartanyan/Andrei Zagorski: A Proposal for a Revised Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., 2019
- Wolfgang Richter: Erneuerung der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa. Vom Gleichgewicht der Blöcke zur regionalen Stabilität in der Krise. Berlin: SWP, Juli 2019
- Buchbesprechungen
- Sammelbesprechung „Entstehung und Verfall internationaler Ordnung“
- Joshua R. Itzkowitz Shifrinson: Rising Titans, Failing Giants. How Great Powers Exploit Power Shifts. Ithaca and London: Cornell University Press 2018, 276 Seiten
- Donald Stoker: Why America Loses Wars. Limited Wars and US Strategy from the Korean War to the Present. Cambridge: Cambridge University Press 2019, 336 Seiten
- Stefan Fröhlich: Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung. Wiesbaden: Springer Verlag 2019. 166 S.
- Bildnachweise
- Disarmament, Demobilization, and Reintegration – An underdeveloped diplomatic tool in Yemen
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Editorial
- Aufsätze
- Die internationale Ordnung: Bestandsaufnahme und Ausblick
- Wie das Unmögliche möglich wurde – Die erfolgreiche Schaffung einer funktionierenden internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg
- Doppelte Wendezeit
- Den Westen neu denken. Wege aus der Krise der freien Welt
- Kurzanalysen und Berichte
- Der INF-Vertrag im Epochenwandel
- Brauchen wir einen Europäischen Sicherheitsrat?
- Ergebnisse internationaler strategischer Studie
- Internationaler Systemwandel
- Kristi Raik/Mika Aaltola/Jyrki Kallio/Katri Pynnöniemi: The Security Strategies of the US, China, Russia and the EU. Living in Different Worlds, Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, Juni 2018
- Peter Rudolf: Der amerikanisch-chinesische Weltkonflikt. Berlin: SWP, Oktober 2019.
- Bobo Lo: Greater Eurasia: The Emperor’s New Clothes or the Idea whose Time Has Come? Paris: Institut français des relations internationales (Ifri), Études de l’Ifri, Russie.Nei.Reports, No. 2, Juli 2019.
- Paul Dibb: How the geopolitical partnership between China and Russia threatens the West. Canberra: ASPI, November 2019
- Cheol Hee Park: Strategic Estrangement between South Korea and Japan as Barrier to Trilateral Cooperation. Washington, D.C.: Atlantic Council, 2019.
- Rüstungskontrolle und regionale Ordnung in Europa
- Samuel Charap/Jeremy Shapiro/Alexandra Dienes/Sergey Afontsev/Péter Balás/Rodica Crudu/James Dobbins/Vasyl Filipchuk/Diana Galoyan/Ulrich Kühn/Andrei Popov/Yauheni Preiherman/Pernille Rieker/Nikolai Silaev/Olesya Vartanyan/Andrei Zagorski: A Proposal for a Revised Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., 2019
- Wolfgang Richter: Erneuerung der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa. Vom Gleichgewicht der Blöcke zur regionalen Stabilität in der Krise. Berlin: SWP, Juli 2019
- Buchbesprechungen
- Sammelbesprechung „Entstehung und Verfall internationaler Ordnung“
- Joshua R. Itzkowitz Shifrinson: Rising Titans, Failing Giants. How Great Powers Exploit Power Shifts. Ithaca and London: Cornell University Press 2018, 276 Seiten
- Donald Stoker: Why America Loses Wars. Limited Wars and US Strategy from the Korean War to the Present. Cambridge: Cambridge University Press 2019, 336 Seiten
- Stefan Fröhlich: Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung. Wiesbaden: Springer Verlag 2019. 166 S.
- Bildnachweise
- Disarmament, Demobilization, and Reintegration – An underdeveloped diplomatic tool in Yemen

