Rezensierte Publikation:
Joachim Dolezik: Die prekäre Verbindung von Menschenrechten und Frieden – zur Ambivalenz des Liberalismus und der Ordnungsmuster des Völkerrechts. Berlin: Duncker und Humblot 2024 320 Seiten
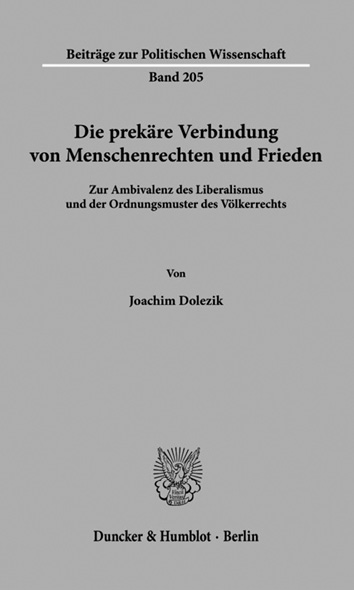
Der Leser der im Herbst 2022 an der Universität Wien angenommenen Dissertationsschrift von Joachim Dolezik ist geneigt, angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine mit all ihren Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen einerseits und der Vielzahl der Konzepte andererseits, Frieden durchzusetzen (von Radikalpazifismus über Realpazifismus bis hin zu dem Anspruch, Russland als Friedensstörer so stark unter Druck zu setzen, dass es zerfällt und damit keine Fähigkeiten mehr besitzt, den Frieden zu stören), an perfekte Vorhersehung zu glauben. Seit Trump 2.0 ist Frieden auch als Oktroi im Rahmen einer Großmachtpolitik denkbar. Offensichtlich trifft das Buch die aktuellen Problemlagen! Der interdisziplinäre Reichtum des Textes aus rechtlichen, sozialwissenschaftlichen, geschichtlichen und philosophischen Gedanken, der hier synthetisiert und zum Schluss auch mit der Problematik des Systemkonflikts des Westens mit autoritären Systemen sowie dem russischen Angriff verwoben wird, belegt gleichermaßen die erhebliche gedankliche Vorarbeit, die in das Promotionskonzept einfloss wie auch die Beziehung zu aktuellen Konflikten, die die Relevanz der Argumente unterfüttern.
Der Verfasser gliedert sein Werk in vier Teile, die die einzelnen Fragestellungen wiederum entlang einiger Kategorien strukturieren, z. B. theoretisch vs. empirisch, normativ vs. positiv, kollektivistisch vs. individualistisch, um nur die wichtigsten zu nennen. Vor diese Hauptteile ist eine Einführung geschaltet, die die Relevanz des Themas entlang dieser Ordnungsprinzipien begründet. Sie setzt die Menschenrechte in ein Spannungsfeld aus einem naturrechtlichen Anspruch des Individuums heraus, der stark mit der sogenannten abendländischen Kultur verwoben ist und mit machtpolitischen Ansprüchen. Kontrastiert wird dies mit dem Gesellschaftsmodell des Liberalismus. Die implizite These der Arbeit, die gerne vom Autor selbst hätte expliziert werden können, lautet offensichtlich, dass mit dem Anspruch der universellen Menschenrechte, quasi wie ein trojanisches Pferd, liberale Konzeptionen transportiert werden, und zwar – um im Bilde zu bleiben – durch alle Mauern und Grenzen hindurch, weshalb Fragen der Macht und ihrer Begründung philosophisch, geschichtlich und ideologisch zu adressieren sind.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Verbindung von Frieden und Menschenrechten. Hierzu werden vom Autor zunächst die Menschenrechtsidee und die Genese des Friedensbegriffes aufbereitet. Sodann werden diese zueinander in Beziehung gesetzt, um dann die Konfliktfälle vor einer abstrakten Gerechtigkeit zu thematisieren, die aber Bezug zu empirisch hochbrisanten Themen wie Flüchtlings- und Minderheitenschutz, Strafverfolgung, Immunität und Amnestien nimmt. Im Spannungsfeld von Staatensouveränität, Selbstbestimmungsrecht und Friedensanspruch wird die Problematik der Durchsetzung des Menschenrechtsanspruches mittels Gewalt angesprochen, die sich in der Weiterentwicklung der Menschenrechte zum humanitären Völkerrecht niederschlägt und Frieden als Ausdruck von Demokratie thematisiert. Es entsteht ein Gegenüber aus den Konzepten des gerechten Krieges und des gerechten Friedens, das nicht aufgelöst wird.
Dem zweiten Teil kommt eine Scharnierfunktion zu, weil hier die politische Frage behandelt wird, in welchem Umfang Menschenrechts- und Völkerrechtstheorien ein vielschichtiges Machtinstrument darstellen, welches mit anderen Diskursen vermischt wird bzw. diese überlagert. Ein Spannungsverhältnis wird offenbar, weil grundlegende völkerrechtliche Regeln, vor allem solche der Kriegsordnung, ausgehöhlt zu werden drohen.
Der dritte Teil widmet sich der Ordnung des Völkerrechts und beginnt mit den drei vom Autor als wesentlich erachteten Säulen: dem kantianischen Universalismus mit starker moralischer Komponente, dem auf einer pessimistischen Gesellschaftskonzeption aufbauenden Realismus in der Tradition von Hobbes einschließlich einer starken Stellung des Staates und einem sich daraus entwickelnden institutionell-evolutorischen Prinzipienkatalog. Durch diesen können Begründungszusammenhänge entfallen, die oft stark vom westlichen Wertekanon geprägt sind und von Staaten mit anderen Traditionslinien als übergriffig, wenn nicht gar imperialistisch aufgefasst werden. Das trägt die tiefliegenden Spannungsfelder an die Oberfläche, und aus diesen ergeben sich dann Kollisionen mit konkreten Machtverhältnissen, vor allem solchen der wirtschaftlichen Art, die in der politischen Ökonomie thematisiert werden. Damit gewinnen nicht-körperliche Gewaltformen an Bedeutung, die nicht im Kriegsvölkerrecht berücksichtigt sind.
Der vierte Teil ordnet die Menschenrechte in die Spannungsfelder der Moderne ein. Das Denken in Zwecken wird beispielsweise ersetzt durch kontingente Narrative, welche Ablaufprozesse innerhalb der Vielzahl der benannten und bekannten Rahmenbedingungen beschreiben: Kollektiv und Individuum, idealistische und realistische Weltsicht, regelbasierte Normen und voluntaristischer Empirismus. In diese lassen sich auch die in der Moderne aufkommenden Identitätsfragen einordnen. Sie erklären, wie es zu einer Gleichzeitigkeit von Zivilisation und Barbarei kommen kann, und ob Menschenrechte als wertebasierte Ordnung oder als werteüberhöhte Waffe aufzufassen sind. Dies führt zu Gegenbewegungen, die neue Feindbilder wie einerseits Liberalismus, andererseits Multikulturalismus entstehen lassen, welche global in die Erklärung des zunehmend manifesten Systemantagonismus des Westens mit China und Russland münden.
Hat sich der Leser durch dieses Dickicht erfolgreich gekämpft und möglicherweise sein eigenes Ordnungssystem gefunden, dann wird er auf den letzten Seiten mit einer Orientierung gebenden Zusammenfassung belohnt. Denn es wird deutlich, dass das liberale, auf Kant zurückgehende Ideal an seine Durchsetzungsgrenzen stößt, dass die Definition der Menschenrechte nicht so einheitlich ist, dass sie klare Implementierungsmacht besitzt und folglich mit dem Liberalismus durchaus im Spannungsverhältnis steht. Auf übergeordneter Ebene lässt sich das Dilemma zwischen völkerrechtlichen Normen und individuellen Menschenrechten nicht abschließend auflösen. Die unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme führen zu kontingenten Handlungssträngen, die als Systemkonflikt materialisieren. Sombart sprach für das Gebiet der Wirtschaft seinerzeit von „Wirtschaftsgesinnungen“ als Quelle des Antagonismus. Damit ist dann auch wieder ein Antagonismus aus der politischen Ökonomie angesprochen, nämlich Macht und Recht und – vielleicht zu wenig beleuchtet – die Ökonomisierung des Rechtes und damit transaktionale Macht – die gerade unter Trump 2.0 relevant wird und mit großem Impetus Völkerrecht oder Menschenrechte durch „Deals“ verdrängt. Für Dolezik bleibt als Fazit, dass die Menschenrechte möglicherweise die letzte Utopie der Moderne sind.
Wie eingangs bereits ausgeführt, ist es das richtige Buch in einer Zeit mangelnder Orientierung, weil es die Spannungsfelder zwischen Ethik und den sie begründenden Moralvorstellungen, den politischen Sachzwängen im Kontext geostrategischer Kalküle und Normativen, teils praktisch, teils philosophisch begründet, ausleuchtet. Der Leser muss sich allerdings durch das Werk, auch die vielen inhaltsreichen Fußnoten, buchstäblich durchkämpfen, wo er leicht die Orientierung verlieren kann. Einige grafische Übersichten, welche die verschiedenen Theoriestränge in Beziehung setzen, wären hier extrem hilfreich gewesen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche starker Kontrastierung: kosmopolitische bzw. globalistische (u. a. auch kollektivistische und damit auch autoritäre bzw. totalitäre Konzepte der Erzwingung) vs. individualistische (u. a. auch stark marktorientierte) Ansätze; normative vs. positive Ansätze; regelgebundene vs. voluntaristische Ansätze. Was fehlt, ist ein starkes Fazit – was folgt also aus der Analyse, was ist zu empfehlen?
Das ist möglicherweise auch die Folge des gewählten Ansatzes, der künftige Entwicklungen nur begrenzt anspricht. Dem Verfasser dieser Zeilen wäre es deshalb sympathisch gewesen, wenn die immer wieder quer zueinander liegenden Argumente, oft antagonistisch positioniert (individuell – kollektiv; normativ – positiv usw.) in ein klassifikationsfähiges System eingestellt worden wären. Denn tatsächlich entwickelt der Autor ein mehrlagiges System, dessen Argumente sich nicht klar orthogonalisieren lassen. Was waren die Erfolgs- oder Misserfolgsgründe für derartige Politiken, Ideen, Ideologien, Regeln usw.? Denn in einem derartigen mehrschichtigen System müssen sie aufgrund des Wettbewerbs als sozialem Prinzip – ob auf den individuellen oder den institutionellen Ebenen – erfolgreich sein, oder sie gehen unter. Die Bausteine dieses Universums aus Menschenrechten, Völkerrecht, Liberalismus, Kollektivismus und Frieden (oder auch Konflikt), um die wichtigsten zu nennen, sind dann als Meme zu verstehen, also kopierfähige soziokulturelle Muster. Sie entstehen, wachsen und vergehen durch Imitation und Replikation. Der Erfolg des Evolutionsalgorithmus definiert sich dann aus der Fähigkeit, aus den vielen Argumenten in den mehrschichtigen Systemen einen tragfähigen „Cocktail“ zu entwickeln. Genau dies ist das Gebiet der Theorie des evolutorischen Institutionalismus.
Gerade angesichts der gegenwärtigen Konflikte und Konfliktpotenziale sind Kooperationsstrukturen, welche Frieden, Liberalität und Menschenrechte durchsetzen sollen, nicht nur positiv zu bewerten, da sie auch als Waffe eingesetzt werden können, was in dem Buch beispielsweise mit dem Stichwort des Werteimperialismus angesprochen wird. Als weitere Idee einer Ordnung wäre zu fragen, welche kooperativen Lösungen in der Tradition von Thomas Hobbes a priori agonal sind, welche im Sinne von John Locke resilient sind und ob diese ins Agonale „kippen“ können – ganz im Sinne des Souveränitätsprinzips von Carl Schmitt, aber auch der Radikallibertären Ayn Rand. Und ob das System nach dem „Kippen“ stabil ist, wäre zu hinterfragen. Der Economist schreibt in seiner Ausgabe vom 12. August 2023: Universelle Werte sind kein Imperialismus, weil nur durch ihre Offenheit der ebenfalls grundlegenden Offenheit sozialer Systeme und damit dem Fortschritt Rechnung getragen wird. Dann würden agonale Systeme nach einiger Zeit im evolutorischen Prozess wegen fehlender Anpassungsfähigkeit, also Fortschrittsfähigkeit, eliminiert werden. Historische Beispiele scheinen dies zu belegen, auf kurze oder mittlere Sicht ist dies aber nur ein unbefriedigendes Versprechen – gerade Russlands Ukrainekrieg zeigt dies.
© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Aufsätze
- Die Seemacht NATO und die USA
- Die Indo-Pazifik-Einsätze europäischer Marinen im Jahr 2024: Rückblick und Bewertung
- Chinas Staatskunst: Kooperation und Zwang – Chinas Strategie zur Spaltung der US-Allianzen in Asien-Pazifik und Europa
- Zwischen Erstschlagsverzicht und einem rapiden Ausbau des Nukleararsenals: Chinas Aufrüstung und wie der Westen darauf reagieren sollte
- Südkoreas Abschreckungsstrategie
- Emerging Force Balances and Postures in South Asia: Trends and Trajectories
- Kurzanalyse
- Japan Without the United States?
- Kommentar
- Europa ohne die USA: Vorwärts in die Vergangenheit?
- Bericht
- „Lethality“, militärischer Solutionismus und die anhaltende Bedeutung von Masse: Beobachtungen von der Land Warfare Conference 2025
- Besprechungen
- Joachim Dolezik: Die prekäre Verbindung von Menschenrechten und Frieden – zur Ambivalenz des Liberalismus und der Ordnungsmuster des Völkerrechts. Berlin: Duncker und Humblot 2024, 320 Seiten
- Joachim Krause: Interdependenz als Waffe. Wirtschaftlicher Druck als Instrument strategischer Einflussnahme Russlands und Chinas. Baden-Baden: Nomos 2025, 163 pages
- Bildnachweise
Articles in the same Issue
- Titelseiten
- Editorial
- Aufsätze
- Die Seemacht NATO und die USA
- Die Indo-Pazifik-Einsätze europäischer Marinen im Jahr 2024: Rückblick und Bewertung
- Chinas Staatskunst: Kooperation und Zwang – Chinas Strategie zur Spaltung der US-Allianzen in Asien-Pazifik und Europa
- Zwischen Erstschlagsverzicht und einem rapiden Ausbau des Nukleararsenals: Chinas Aufrüstung und wie der Westen darauf reagieren sollte
- Südkoreas Abschreckungsstrategie
- Emerging Force Balances and Postures in South Asia: Trends and Trajectories
- Kurzanalyse
- Japan Without the United States?
- Kommentar
- Europa ohne die USA: Vorwärts in die Vergangenheit?
- Bericht
- „Lethality“, militärischer Solutionismus und die anhaltende Bedeutung von Masse: Beobachtungen von der Land Warfare Conference 2025
- Besprechungen
- Joachim Dolezik: Die prekäre Verbindung von Menschenrechten und Frieden – zur Ambivalenz des Liberalismus und der Ordnungsmuster des Völkerrechts. Berlin: Duncker und Humblot 2024, 320 Seiten
- Joachim Krause: Interdependenz als Waffe. Wirtschaftlicher Druck als Instrument strategischer Einflussnahme Russlands und Chinas. Baden-Baden: Nomos 2025, 163 pages
- Bildnachweise


