PWP: Herr Professor Trebesch, ein wichtiger Komplex Ihrer aktuellen Arbeit ist der sogenannte Ukraine Support Tracker, eine Datenbank, die Sie gemeinsam mit Ihrem Team am Institut für Weltwirtschaft geschaffen haben und regelmäßig erweitern sowie auswerten.[1] Sie beziffern den Wert der Unterstützung des Landes durch 41 westliche Staaten seit der russischen Invasion im Februar 2022. Wie ist dieses große und politisch äußerst bedeutsame Projekt zustande gekommen?
Trebesch: Die wissenschaftliche Wurzel liegt an einem Ort, wo man sie vielleicht nicht vermuten würde: in meiner Arbeit zu Schuldenkrisen. Mit diesem Thema begann meine akademische Karriere, und es beschäftigt mich auch heute noch. Eine große Agenda in meiner Forschung gemeinsam mit Carmen Reinhart und Sebastian Horn besteht darin, die Kredite und Transfers zwischen Staaten zu verstehen. In der Regel liegt das Augenmerk ja auf den privaten Kapitalflüssen, nicht auf den staatlichen. Doch das Volumen zwischenstaatlicher Kredite ist enorm. Gerade in Krisensituationen wie Naturkatastrophen, Kriegen, Pandemien, aber auch Finanzkrisen übersteigen die staatlichen die privaten internationalen Geldströme deutlich. Dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine, und ich habe mich bald gefragt, warum sich eigentlich niemand die staatlichen Hilfen an die Ukraine systematischer anschaut. Jede Regierung brüstete sich zu Beginn des Krieges als großer Unterstützer, aber zuverlässige Zahlen gab es nicht. Mich hat die Diskrepanz zwischen Rhetorik und tatsächlicher Hilfe von Anfang an geärgert, und ich wollte als Forscher einen Beitrag leisten. Und da nach einigen Wochen immer noch niemand anderes mit guten Zahlen um die Ecke kam, habe ich das halt selber angepackt, anfangs mit zwei Praktikantinnen.

PWP: Sehr verdienstvoll – aber müsste das nicht eine einschlägige supranationale Organisation machen, zum Beispiel die NATO?
Trebesch: Ja, das dachte und denke ich auch. Solche Daten zu sammeln, sollte die Aufgabe der NATO oder der Europäischen Kommission sein. Diese Institutionen haben große, qualifizierte Bürokratieapparate und viel Geld. Andererseits hat man als Wissenschaftler auch mehr Freiheit und Flexibilität, so etwas in wenigen Wochen aufzuziehen. Niemand redet einem rein und man muss nicht auf politische Empfindlichkeiten achten. Diese Zahlen sind ja politisch oft unbequem.
PWP: Was zählen Sie genau?
Trebesch: Wir erfassen die militärische, finanzielle und humanitäre Unterstützung, die der Ukraine zuteilwird. Das heißt, wir zählen Kredite, Kreditgarantien, Medikamente, Nahrungsmittel, Panzer, Haubitzen, Luftabwehrsysteme, also jedwede Hilfsleistungen von ausländischen Regierungen.
PWP: Kredite kann man beziffern, aber alles andere muss erst einmal bewertet werden. Und man muss wissen, wer überhaupt welche Hilfen leistet.
Trebesch: Genau, das war gerade zu Beginn die größte Herausforderung. Zunächst mussten wir viele Umwege gehen und beispielsweise auf geleakte Listen militärischer Hilfe zugreifen, die in der Presse herauskamen. Unsere eherne Regel ist aber seit jeher, dass die Informationen, die wir verwenden, öffentlich verfügbar sein müssen. Wir nutzen nichts, was uns nur vertraulich zugespielt wird. Heute müssen wir auch nicht mehr so viel „basteln“, da die meisten Länder detaillierte Übersichten über ihre Hilfsleistungen veröffentlichen. Dabei hat sich auch gezeigt, dass unsere frühen Schätzungen überraschend gut waren, trotz der mangelnden Transparenz; wir mussten im Nachhinein nur selten größere Korrekturen vornehmen. Einer der Gründe dafür liegt darin, dass dieser Krieg auch über die sozialen Medien ausgetragen wird. Wenn ein Waffensystem versprochen wird, liest man das dort zuerst, etwa weil eine Politikerin dazu tweetet. Dass es große „versteckte Hilfen“ gibt, ist ein Mythos.
PWP: Wie bewertet man Waffensysteme? Kennen Sie die Preise der Rüstungsindustrie?
Trebesch: Wir haben mittlerweile für die meisten Waffen zuverlässige Quellen. Wir können Preise unter anderem aus Verträgen ziehen, die zwischen Rüstungsfirmen und Regierungen geschlossen wurden, und wir vergleichen immer mehrere Quellen. Mittlerweile sind die Preise, die wir verwenden, gut genug, um zuverlässig zu bewerten.
PWP: Sie mussten sich auch mit so komplizierten Konstruktionen wie dem Ringtausch von militärischer Ausrüstung herumschlagen.
Trebesch: Das ist ja zum Glück ein Deutschland-Spezifikum. International spielte der Ringtausch keine große Rolle. Wie man den Ringtausch bewertet, spielt daher für das große Ganze ebenfalls kaum eine Rolle.
PWP: Anfangs konnten Sie nur Angaben über zugesagte, nicht über tatsächlich ausgelieferte Hilfen machen.
Trebesch: Da sind wir inzwischen weiter. Mittlerweile zählen wir Mittelzuweisungen („allocations“). Das heißt, die jeweilige Regierung muss ganz konkret mitgeteilt haben, was sie geliefert oder zur Lieferung vorbereitet hat.
PWP: Können Sie also die Lücke zwischen dem Versprochenen und dem Gelieferten klar bestimmen? Politisch ist sie ja einigermaßen brisant.
Trebesch: Ja. Anfangs war es so, dass Deutschland deutlich mehr angekündigt als geliefert hat. Die Auslieferungen waren sehr langsam. Polen hat das genau umgekehrt gehandhabt und erst geliefert und dann darüber berichtet. Die Vereinigten Staaten liegen irgendwo in der Mitte. Insgesamt ist die Lücke immer noch groß. Ich war vor allem erstaunt, wie wenig die Europäer auf das zwischenzeitliche Einfrieren der amerikanischen Hilfen reagiert haben. Wegen der Blockade im Kongress der Vereinigten Staaten kam fast ein Jahr lang keine neue Hilfe aus Amerika, aber die Europäer haben so weitergemacht, als sei nichts passiert. Das Resultat war ein starker Rückgang der Hilfen insgesamt und ein Stocken der ukrainischen Vorstöße.
PWP: Wie stehen Deutschland, die Schweiz und Österreich – die drei im Verein für Socialpolitik vertretenen Länder – im Ranking da?
Trebesch: Deutschland ist absolut gesehen, mit mehr als 15 Milliarden Euro bilateraler Hilfe, der größte europäische Unterstützer der Ukraine und liegt auf Platz 2 hinter den Vereinigten Staaten. Deutschland ist aber auch die größte Volkswirtschaft Europas. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also wenn man für die Landesgröße kontrolliert, liegt Deutschland eher im Mittelfeld. Die Osteuropäer, aber auch Dänemark, die Niederlande oder Norwegen tun deutlich mehr, zum Teil drei- oder viermal so viel. Die Schweiz und Österreich stehen dann nochmal schlechter da. Sie liegen im unteren Drittel der mehr als 40 Länder in unserem Ranking, sowohl in absoluten Zahlen, in Milliarden Euro, als auch gemessen am BIP. Der deutschsprachige Raum sticht also insgesamt nicht als sonderlich hilfsbereit hervor.
PWP: Sind finanzielle Werte und BIP-Anteile wirklich die relevante Messgröße, wenn man die Unterstützung der Ukraine in den Blick nimmt? Letztlich misst man damit ja nur den ökonomischen Aufwand, nicht aber die viel wichtigere militärische Wirksamkeit.
Trebesch: Als Ökonomen können wir durchaus davon ausgehen, dass es eine Korrelation zwischen Marktpreis und Wirksamkeit gibt. Wenn die „Panzerhaubitze 2000“ dreimal so viel kostet wie eine alte sowjetische Haubitze, dann wird es auch in Sachen Effektivität deutliche Unterschiede geben. Außerdem geht dem Bewerten ja das Zählen der Waffen und Waffensysteme voraus. Für die großen Kategorien wie Panzer, Haubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehr haben wir auch die Auflistung jedes einzelnen Waffensystems online gestellt. Das kann sich jeder ansehen. Militärexperten können dann auf dieser Basis bewerten, welches Land besonders wichtige militärische Hilfe leistet.
PWP: Eine methodische Nachfrage noch zur EU: Behandeln Sie sie als eigenen Akteur oder brechen Sie die Summen auf die Mitgliedstaaten herunter, gewichtet nach den üblichen Haushaltsanteilen?
Trebesch: Wir tun beides. Es ist sauberer, das getrennt auszuweisen. Frankreich und Italien zum Beispiel unterstützen die Ukraine vor allem indirekt, über die jeweiligen EU-Töpfe. Bilateral hingegen ist deren Hilfe überraschend gering, von einigen wichtigen Waffensystemen einmal abgesehen. Es ist dabei wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die EU als solche ja keine Militärhilfe leistet, sondern nur finanzielle Unterstützung bietet. Die Militärhilfe muss auf bilateralem Weg von den Mitgliedstaaten kommen. Daher weisen wir bilaterale und EU-Hilfen separat aus.
PWP: Ihnen sind die staatlichen Hilfsströme wichtig – aber was ist eigentlich mit der privaten Hilfe? Kann man auch nur annäherungsweise erfassen, wieviel Privatpersonen und private Institutionen der Ukraine an Unterstützung geleistet haben, sei es in Form einer Finanzierung beispielsweise von Stromgeneratoren und Schutzwesten oder schlicht in Form von Geld?
Trebesch: Das würde mich auch interessieren, aber das kann man derzeit leider, zumal über viele Unterstützerländer hinweg, kaum sauber messen und vergleichen. Die Lehre aus der Geschichte ist aber, dass es letztlich die Staaten sind, die in großen Krisen und Kriegen den Unterschied machen bei der internationalen Unterstützung. Die Volumina der staatlichen Hilfe waren und sind ein Vielfaches höher als die private Unterstützung.
PWP: Der Ukraine Support Tracker ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund so bedeutsam, dass nach dem neuerlichen Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten ein Versiegen der amerikanischen Hilfe zu befürchten ist. Trump ist das Musterbeispiel eines Populisten. Zum Populismus haben Sie ebenfalls geforscht.[2] Wie kam das?
Trebesch: Das Phänomen des Populismus interessiert mich schon lange. Ich habe als Jugendlicher in Italien miterlebt, wie das Land unter Silvio Berlusconi wirtschaftlich abrutschte und auch das Niveau der gesellschaftlichen Diskurse deutlich sank. Und ich habe argentinische Koautoren, für die der Populismus traurige Normalität ist. Bereits vor dem Brexit und der Wahl Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahr 2016 haben wir unser erstes Papier dazu publiziert, und danach haben wir dann nochmal tiefer gebohrt. Damals gab es nur sehr wenige Ökonomen, die dieses Thema angefasst haben. Anfangs ist meinen Kieler Kollegen Manuel Funke und Moritz Schularick und mir selbst viel Skepsis entgegengeschlagen.
PWP: Welche Einwände gab es?
Trebesch: Es hieß, das Konzept „Populismus“ sei verwirrend und wissenschaftlich wenig nützlich; man habe mit Konzepten wie „Autokratie“ und „Diktatur“ bereits das nötige Handwerkszeug. Da war ich ganz anderer Meinung. Ich bin bis heute der Überzeugung, dass Populismus ein eigenes Phänomen ist, das man auch separat erforschen und verstehen muss. Mir war klar, dass dieses Thema uns noch lange umtreiben würde, und dass der Populismus eine der größten Gefahren für wirtschaftliche Offenheit und für unsere liberale Demokratie ist. Und ich finde, wir können es uns als Ökonomen nicht leisten, das Thema allein den Politikwissenschaftlern zu überlassen.
PWP: Warum?
Trebesch: Es ist zu wichtig. Dafür geht es zu sehr ins Mark, auch in das unsere als Forscher. Populisten schaden der Wirtschaft und auch der Wissenschaft. Sie bauen die Forschung an Universitäten ab und greifen in die Wissenschaftsfreiheit und in die Lehrpläne an Schulen ein. Schon aus purem Eigeninteresse müssen wir verstehen, was da geschieht und auf uns zukommen könnte. Aber es ist mehr als das, was mich motiviert. Ich habe drei Kinder und möchte auch deshalb etwas dazu beitragen, dass Europa dieser offene Kontinent bleibt, wie ich ihn habe erleben dürfen, und dass Frieden herrscht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Vladimir Putin nicht nur den größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, sondern auch von den meisten populistischen Parteien in Europa offen bewundert wird. Populismus und Krieg sind in Europa eng miteinander verbunden.
PWP: Sie möchten zwar das Thema Populismus nicht den Politikwissenschaftlern allein überlassen, aber Sie greifen schon auf deren Definitionen zurück, um einzugrenzen, was genau als Populismus gelten kann, nicht wahr?
Trebesch: Ja, wir arbeiten mit der Arbeitsdefinition, wie sie sich im Anschluss an den Politologen Cas Mudde durchgesetzt hat.[3] Im Kern dieser Definition steht, dass der Populist polarisiert, indem er einen imaginären Konflikt zwischen „dem Volk“ und „der Elite“ heraufbeschwört und diesen Konflikt dann ins Zentrum seines Wahlkampfs und seiner Regierungsaktivität stellt. Es geht dabei um Spaltung, um den Gegensatz „wir gegen die“. Das ist nichts anderes als eine ziemlich plumpe rhetorische Formel, die so lange wiederholt wird, bis sie sich in den Köpfen der Leute festsetzt – und diese Strategie ist erschreckend erfolgreich. Diese Definition hat für uns wissenschaftlich den Vorzug, flexibel genug zu sein, dass man sie auf eine große Breite von Fällen anwenden kann, auch im historischen Kontext, in einer Vielzahl von Ländern und politischen Systemen.

PWP: Lässt Ihnen die gewählte Arbeitsdefinition die Möglichkeit, inhaltlich noch zwischen Populismus verschiedener Couleur zu unterscheiden, zum Beispiel schlicht zwischen Rechts- und Linkspopulisten?
Trebesch: Ja. Wir haben uns bemüht, rechts und links klar abzugrenzen. In 90 Prozent der Fälle gelingt das auch. Aber natürlich gibt es Grenzfälle, zum Beispiel den slowakischen Premierminister Robert Fico: Er ist ein Sozialdemokrat, der aber ausgesprochen rechts steht. Das Kriterium, um rechts und links zu unterscheiden, ist es, welche Elite angegriffen wird. Im Fall von Linkspopulisten ist es die Wirtschafts- und Finanzelite, einschließlich der globalen Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds. Rechtspopulisten polarisieren eher gegen ethnische Minderheiten und Einwanderer, und sie werfen den Eliten vor, mit diesen Minderheiten unter einer Decke zu stecken und auf diese Weise dem Interesse des „wahren Volkes“ entgegenzuwirken.
PWP: Sie haben sich nicht so sehr mit der Frage beschäftigt, wie Populismus überhaupt aufkommt, wie das viele Politikwissenschaftler tun und getan haben, sondern damit, was seine wirtschaftlichen Folgen sind. Also mit der Frage: Ist Populismus teuer? Wenig überraschend lautet Ihre Antwort „ja“.
Trebesch: So wenig überraschend ist das gar nicht. Es gibt durchaus Fälle, in denen eine populistische Regierung wirtschaftliche Erfolge erzielen kann, zum Beispiel Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei, Narendra Modi in Indien, die PiS-Regierung in Polen oder Donald Trump in Amerika. Gerade in den ersten Regierungsjahren sind die Wachstumsraten teilweise nicht so schlecht. Wir stellen aber fest, dass es mittel- und langfristig fast immer abwärts geht. Da sehen wir wirklich starke Unterschiede, und das liegt nach unseren Ergebnissen vor allem an der Erosion von Institutionen und am zunehmenden Protektionismus. Dafür ist ja schon der Brexit ein gutes Beispiel. Anfangs erschien der wirtschaftliche Schock kleiner als erwartet, aber heute sind die enormen Kosten zu erkennen, die diese Entscheidung verursacht hat. Auch in Italien schien es unter Berlusconi Mitte der neunziger Jahre noch ganz gut zu laufen. Dass das Land in die wirtschaftliche Stagnation hereingerutscht ist, sieht man erst heute.
PWP: Das ist intuitiv plausibel, aber um solche Aussagen zu machen, brauchen Sie ein Counterfactual: ein plausibles Alternativszenario, an dem Sie die Realität messen. Wo nehmen Sie das her?
Trebesch: Wir nutzen die sogenannte synthetische Kontrollmethode.[4] Mit dieser Methode kreieren wir sozusagen Doppelgänger-Länder. Wenn man sich beispielsweise dafür interessiert, wie sich das BIP der Türkei entwickelt hätte, wenn der Populist Erdoğan nicht Präsident geworden wäre, dann nimmt man die BIP-Zeitreihen aller Länder und gewichtet sie so, dass die Zeitreihe möglichst genau die tatsächliche Entwicklung des BIP in der Türkei bis zur Wahl Erdoğans 2003 abbildet. Und dann lasse ich diese Zeitreihe mit den gewählten Gewichten weiterlaufen. Die Zahlen für diese kontrafaktische Doppelgänger-Türkei vergleiche ich mit den tatsächlichen BIP-Zahlen, wie sie sich nach Erdoğans Wahl zum Präsidenten ergeben haben. Die Lücke zwischen diesen beiden Reihen ist dann als Effekt dem Ereignis von 2003 zuzuweisen, der Wahl Erdoğans.
PWP: Die Wirtschaftsprogramme rechter Populisten muten zumindest kurzfristig oft nicht ganz so schädlich an wie jene linker Populisten – zu diesem Urteil gelangte auch Olivier Blanchard vor der jüngsten Parlamentswahl in Frankreich.[5] Sehen Sie in ihrer Studie solche Unterschiede zwischen der ökonomischen Schädlichkeit rechter und linker Populisten? Bestätigt sich das mit Ihren Daten?
Trebesch: Sowohl Links- als auch Rechtspopulisten schaden der Wirtschaft. Populisten jeglicher Couleur verfolgen wirtschaftlichen Nationalismus und Protektionismus. Linke Populisten haben zusätzlich eher die Neigung zu hohen Haushaltsdefiziten und stärkerer Inflation. Rechte Nationalisten schaden eher den demokratischen Institutionen, und sie höhlen politische Checks and Balances und den Rechtsstaat aus.
PWP: Aber das geschieht wahrscheinlich nicht abrupt, sondern in mittlerer oder längerer Frist?
Trebesch: An dieser Frage sind wir gerade dran. Wir fragen uns, wann sich Populisten zu Diktatoren wandeln. Diese Entwicklung setzt typischerweise ab der zweiten Amtszeit ein. Mit der Zeit wird das autoritäre Element immer stärker. Das hat man auch in Polen mit der PiS gesehen, bei Erdoğan in der Türkei, oder bei Orbán in Ungarn. Die nun anstehende zweite Amtszeit Trumps wird vermutlich sehr viel folgenschwerer sein als die erste.
PWP: Damit dürften sich auch verzögerte Auswirkungen ergeben, dergestalt, dass sich ausländische Investoren noch nicht gleich nach der Wahl eines Populisten aus solchen Ländern zurückziehen, sondern erst dann, wenn erkennbar wird, dass der Rechtsstaat unter die Räder kommt und auch für sie keine Rechtssicherheit mehr verfügbar ist. Mit Blick auf die aktuellen Populisten entsteht das Beobachtungsmaterial gerade erst. Aber ich nehme an, dass Sie auch in diesem Themenkomplex wieder viel aus der Geschichte lernen können?
Trebesch: Ja, die Geschichte steckt auch hier wieder voller interessanter Anschauungsfälle. Man nehme beispielsweise Juan Perón in Argentinien, der nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals an die Macht kam. Er war anfangs ein sehr beliebter, demokratischer Politiker, wurde dann später aber zum Diktator. Silvio Berlusconi hingegen, der zwischen 1994 und 2011 mehrfach Ministerpräsident in Italien war, hat die institutionellen Checks and Balances intakt gelassen. Er hat lautstark gegen die Justiz gepoltert und ein paar Gesetze erlassen, um sich selbst vor Strafverfolgung zu schützen, aber er hat deshalb noch lange nicht das Verfassungsgericht entkernt. Es ist spannend, sich immer wieder solche Variationen anzusehen.
PWP: Berlusconi hatte Medienmacht.
Trebesch: Klar. Und er war mit seinem Populismus ein Vorreiter in Italien. Unsere Daten zeigen ja auch, dass Populismus ein serielles Phänomen ist. Ein Land, das einmal einen Populisten an der Regierung gehabt hat, hat auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, später wieder einen Populisten an die Macht zu bringen. In unserer Gegenwart sind nun zahlreiche neue Populisten an die Macht gekommen. Man muss also damit rechnen, dass das auch wieder geschehen wird. Wir leben in einem populistischen Zeitalter. Und das geht nicht so schnell wieder weg. Eine große Frage in diesem Kontext ist, ob die Vereinigten Staaten zu einer Art Argentinien werden, wo sich Populisten immer wieder mit Nicht-Populisten an der Macht abwechseln. Die Populisten schaffen Chaos und die Nicht-Populisten sind im Anschluss mit Aufräumen beschäftigt, bis alles wieder von vorne losgeht. In Argentinien ist das Ergebnis dieses Pingpongs ökonomisch eine der schlechtesten Wachstums-Performances der Welt. Man kann auch aus diesem Fall viel lernen, und ich mache mir schon große Sorgen darum, was mit den Vereinigten Staaten geschieht.
PWP: Diese Sorgen muss man sich ja nicht nur mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung machen, sondern auch mit Blick auf Geopolitik und Geoökonomie. In dieser Hinsicht ist China der Elefant im Raum. Sie haben unter anderem auch zur Rolle Chinas als Gläubiger und zur versteckten Verschuldung von Entwicklungsländern geforscht. Warum ist das wichtig; warum sollten wir darüber mehr wissen?
Trebesch: Schon deshalb, weil versteckte Schulden immer dann ans Licht kommen, wenn es brennt – also dann, wenn die Krise da ist. Schuldenkrisen, wie auch seinerzeit die Eurokrise, werden immer wieder auch durch versteckte Schulden und versteckte Defizite ausgelöst. Dass wir gute, akkurate Schuldenstatistiken haben, ist essenziell ex ante zur Bepreisung von Risiken und ex post auch für ein angemessenes Krisenmanagement. Der Fall China ist nun besonders drastisch. Es gibt kaum Transparenz, und gleichzeitig ist das Land zu einem der größten Kreditgeber im globalen Süden geworden. Für die Stabilität des globalen Finanzsystems ist es wichtig zu wissen, wo diese Schulden liegen.
PWP: Von welchen Größenordnungen reden wir, wenn Sie von versteckten Schulden gegenüber China sprechen?
Trebesch: In meinem ersten Papier zu diesem Thema gemeinsam mit Sebastian Horn und Carmen Reinhart zeigen wir, dass etwa 50 Prozent von Chinas Krediten nicht in den Statistiken von Internationalem Währungsfonds und Weltbank auftauchen.[6] Auf diesen Beitrag gab es zunächst sehr kritische Reaktionen, aber mittlerweile hat sich unsere Sicht durchgesetzt. Selbst der IWF spricht heute von „Hidden debt“. In einer neueren Arbeit zeigen wir zudem, dass es nicht nur viel „Hidden debt“, sondern auch „Hidden defaults“ gibt.[7] Es gibt also Schuldenkrisen und Umstrukturierungen, von denen keiner so recht etwas mitbekommen hat, die aber trotzdem von erheblicher Bedeutung sind. Und zuletzt haben wir herausgefunden, dass es „Hidden bailouts“ gibt, also große, nicht transparent gemachte Rettungskredite, insbesondere eben durch China.[8] Es gab zwar vereinzelt Anekdoten in der Presse, dass China als Krisenmanager auftritt, aber einen systematischen Überblick gab es bisher nicht – den liefern wir jetzt.
PWP: Was ergibt dieser Überblick?
Trebesch: China ist mittlerweile einer der wichtigsten Krisenmanager geworden. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 100 Milliarden Euro Rettungsgelder bereitgestellt; das sind enorme Summen für Entwicklungsländer. Die größere Einsicht ist aber, dass wir durch den Aufstieg des globalen Südens in einer neuen Welt leben. Die globale Finanzarchitektur ist heute intransparenter und multipolarer, als wir das gewohnt sind. Es reicht nicht mehr, sich in Washington D.C. umzuhören. Heute braucht es intensive Recherche, um herauszufinden, was die Chinesen, die Inder oder die Saudis international machen. Zudem läuft immer mehr über Steueroasen, in die man schwer Einblick hat. Die Datenlage ist zunehmend verwirrend.
PWP: Auch hier stellt sich die Frage, wie Sie denn, wenn die Datenlage so verwirrend ist, an das notwendige Material gekommen sind.
Trebesch: Das war mühsam und hat lange gedauert. Uns hat hier die Zusammenarbeit mit Brad Parks von AidData geholfen, einem stark von der amerikanischen Regierung finanzierten Thinktank. AidData ist meines Erachtens eine der besten Antworten auf die „Neue Seidenstraße“, weil mit ihrer Hilfe die Aktivitäten Chinas systematisch aufgearbeitet werden können. Wir arbeiten zusammen, weil AidData die Daten und das Fallwissen hat und wir die Expertise zu Finanzmärkten und Staatsschulden. Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten sehr gewinnbringend.
PWP: Diese Arbeit ist gerade deshalb so wichtig, weil China geopolitische Ambitionen hat, die einem Sorgen bereiten können.
Trebesch: So ist es. Der Bedeutungsgewinn Chinas ist enorm. Als ich seinerzeit in Berlin mit meiner Dissertation zu Schuldenkrisen anfing, war von der Volksrepublik noch nichts zu sehen. Aber heute kann man praktisch keine Schuldenkrise mehr ohne China lösen.
PWP: Wie sind die Reaktionen aus China zu Ihrer Arbeit? Haben Sie sich mit dem Offenlegen dieser Rolle des Landes missliebig gemacht?
Trebesch: Natürlich gab es in der chinesischen Presse auch offene Kritik. Unsere Ergebnisse sind nicht sonderlich bequem. Aber es gab auch Zuspruch und Ermutigung, und die Chinesen greifen selber gern auf unsere Daten zurück.
Mit Christoph Trebesch sprach Karen Horn. Fotos privat.
Zur Person
Christoph Trebesch: Internationale Finanzen, politische Ökonomie, Geoökonomie
Karen Horn
Dass ihm ausgerechnet an der Technischen Universität (TU) Berlin auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik der Hermann-Heinrich-Gossen-Preis verliehen wurde, dürfte Christoph Trebesch besonders gefreut haben. An der TU Berlin hatte der heutige Professor für Makroökonomik an der Universität Kiel und Direktor des Forschungszentrums Internationale Finanzmärkte am Institut für Weltwirtschaft (IfW) einst zu studieren begonnen. Die Anreise zur Preisverleihung war allerdings deutlich länger als sonst von seiner Wirkungsstätte an der Kieler Förde oder seinem Wohnort Hamburg beispielsweise zu den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium: Trebesch forscht derzeit zu Gast in Stanford.
Der kurzfristige Spagat über die Kontinente hinweg passt bestens zum Gossen-Preis, der just die weitere Internationalisierung der deutschen Wirtschaftswissenschaften fördern soll. Die Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik, Regina Riphahn, hob in ihrer Würdigung des 44 Jahre alten Trebesch als „Aushängeschild deutscher Spitzenforschung“ besonders die Vielzahl seiner aktuellen und hochrelevanten Veröffentlichungen in Topjournals wie American Economic Review, Quarterly Journal of Economics und Journal of Political Economy zu Themen der internationalen Finanzen, der politischen Ökonomie und der Geoökonomie hervor.[9]
Als Trebesch Ende der neunziger Jahre das Studium aufnahm, galt sein Interesse allerdings zuerst der Betriebswirtschaftslehre. Im Boom der „New Economy“ sah er sich schon als künftigen Unternehmer. Und dass er sich für die TU entschied, lag an deren für ihn attraktivem Erasmus-Programm. Denn der Diplomatensohn, in Brüssel geboren und in Bonn, Rom und Helsinki aufgewachsen, suchte nach dem in der früheren Bundeshauptstadt absolvierten Abitur rasch wieder den Weg die Ferne. Doch dann langweilten ihn die Lehrveranstaltungen; das innovative Potenzial des Unternehmertums, das ihn gelockt hatte, fand er in den BWL-Fächern nicht wieder. Und schon gar nicht wurden die ganz großen, wichtigen Fragen gestellt. Nur für die Pflichtveranstaltungen zur Volkswirtschaftslehre konnte er sich erwärmen. Besonders Jürgen Kromphardts Makroökonomik-Vorlesung faszinierte ihn. Durch das Grundstudium biss er sich durch, nutzte noch das Erasmus-Programm für ein Auslandsjahr in Madrid, wechselte dann aber nach seiner Rückkehr nach Berlin von der TU an die Freie Universität (FU) und von der BWL zur Volkswirtschaftslehre. An der FU fand er zur Ökonometrie als nützlichem Instrument zur empirischen Untersuchung gesellschaftlicher Entwicklungen. „Die Macht der Daten hat mich von Anfang an fasziniert“ bekräftigt er heute. Neben der methodischen Arbeit interessierte er sich damals an der FU inhaltlich vertieft für Fragen des Wachstums, des Handels und der Finanzwirtschaft.
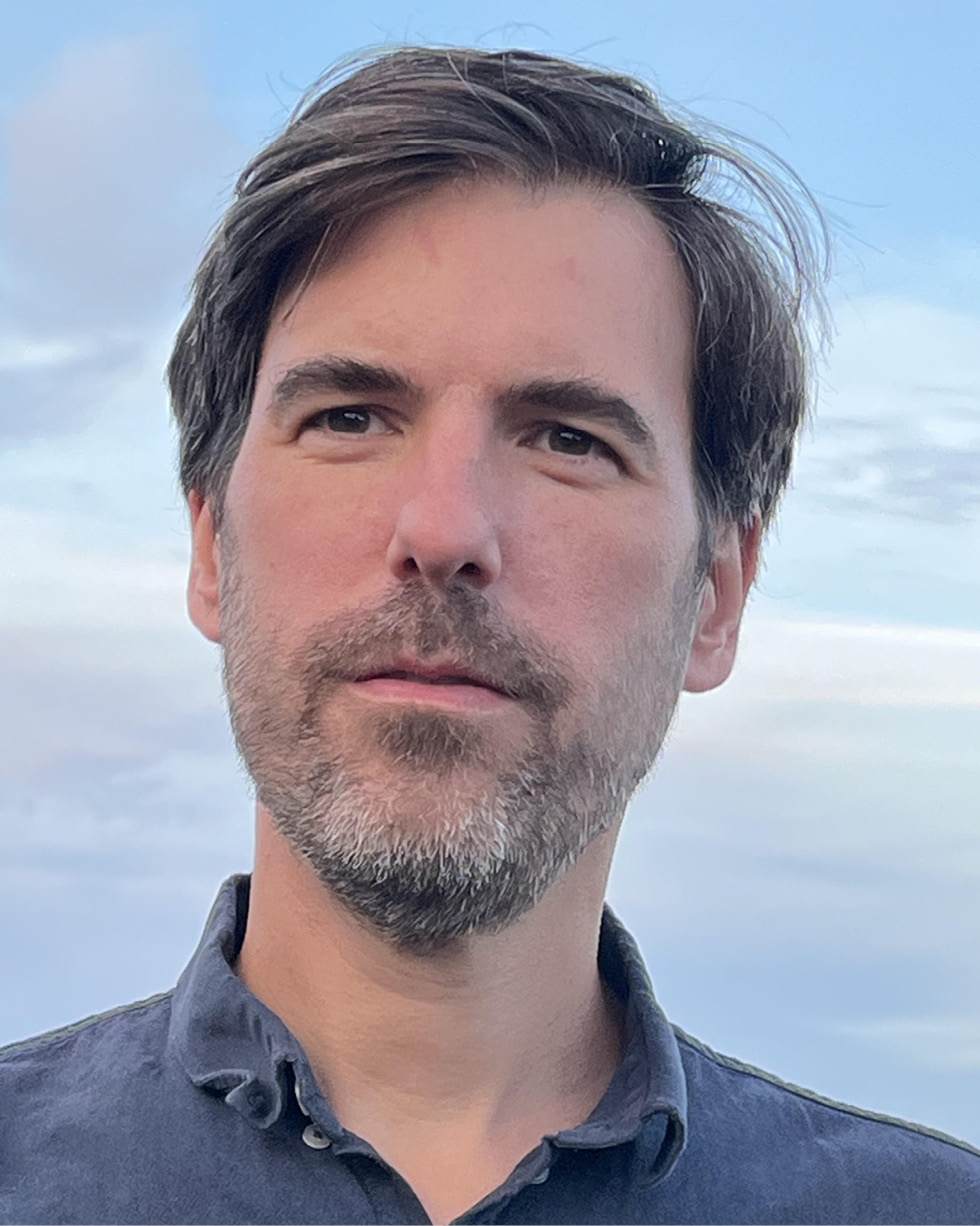
Nach dem Diplom nahm Trebesch am Advanced Studies Program des IfW Kiel teil. „Das Jahr dort hat mich sehr stark geprägt“, erzählt er. „Die amerikanischen Dozenten, die in Kiel lehrten, kamen mit Flip-Flops in den Seminarraum, aber sie arbeiteten unmittelbar an der Forschungsfront und rissen uns mit.“ Erst durch ihr Feuer habe er auch er selbst angefangen, für die Wissenschaft zu brennen. Über ein Drittmittelprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft landete er im Jahr 2007 schließlich wieder an der FU Berlin und beim Thema Finanzkrisen, das ihn neben anderen Fragen auch heute noch beschäftigt. Im Zentrum seines von Henrik Enderlein und Helge Berger begleiteten Promotionsprojekts standen Schwellenländer. Trebesch begann die Finanzkrisen Argentiniens, Russlands und Indonesiens systematisch zu analysieren und herauszufinden, warum die jeweiligen Krisenprozesse sich so stark unterschieden. Zunächst galt es hierfür eine internationale Datenbank zusammenzustellen. Gemeinsam mit einem Wissenschaftler in Argentinien, Juan Cruces, sammelte er Daten über 180 Krisen in 68 Ländern und wertete sie aus. Es zeigte sich: Je höher der Schuldenschnitt ist, den ein Gläubiger hinnehmen muss, desto schwieriger gestaltet sich der Weg aus der Schuldenkrise und desto höher sind auch die Zinsaufschläge, die ein Krisenland langfristig zahlen muss.
Das Thema Schuldenkrisen reizte ihn besonders, weil es die Perspektiven der Makroökonomik, der Finanzen und der Politischen Ökonomie miteinander verband. Doch so wurde es damals kaum wahrgenommen. Schuldenkrisen galten lange als Nischenthema. „Mit der Nachhaltigkeit von Staatsschulden befasste man sich in der klassischen Makroökonomik durchaus, aber was passiert, wenn es zur Überschuldung kommt, zu Runs, zu Umstrukturierungen – solche Fragen galten als Probleme der Entwicklungsökonomik.“ Das änderte sich mit der Eurokrise und Griechenland: „Plötzlich war ich in den Augen der Öffentlichkeit ein europäischer Makroökonom, der an einem hochrelevanten Thema arbeitete.“ Nun konnte er entgegen allen Widerständen zeigen, dass sich aus den Krisenerfahrungen von Schwellenländern auch für Industrieländer durchaus etwas lernen lässt. Auch wenn sich über Länder und Zeiten hinweg Akteure, Institutionen und Bedingungen mitunter deutlich unterschieden, hätten die Grundprozesse doch viele Gemeinsamkeiten.
Ein Jahr an der Yale University rundete die Promotionsarbeiten ab. Auch diese Erfahrung prägte Trebesch: Ihn beeindruckte die große Ernsthaftigkeit einer wirklich gründlichen und tiefschürfenden Forschung, die sich unter anderem auch in der erheblichen Dauer der Forschungsprojekte zeigte. „So wollte ich auch arbeiten.“ Nach der Promotion bekam er 2011 den Ruf auf eine Juniorprofessur für öffentliche Finanzen an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die an das Center for Economic Studies (CES) gekoppelt war. „So tauchte ich ein wenig in das Hans-Werner-Sinn-Universum und das CESifo Netzwerk ein, und es war eine sehr spannende Zeit.“
Damals begann auch, über den Atlantik hinweg, seine Zusammenarbeit mit Carmen Reinhart von der Harvard Kennedy School. Er hatte sie wegen seiner in der Promotionszeit begonnen Forschung zu Schuldenschnitten („Haircuts“) angeschrieben. „Sie wurde meine Mentorin“, sagt er im Rückblick dankbar. „Sie ist eine intellektuell sehr beeindruckende Person und als Mensch sehr warmherzig.“ Gemeinsam veröffentlichten sie unter anderem einen wirtschaftshistorisch weit ausgreifenden Aufsatz zur Schuldenkrise Griechenlands, in dem sie ihr Augenmerk auf die chronische, wiederholt zum Ruin führende Abhängigkeit des Landes von ausländischem Kapital richteten.[10]
Nach sechs Jahren in München wechselte Trebesch ans IfW Kiel, wo ihn die weltwirtschaftliche Ausrichtung und das vom damaligen Präsidenten Dennis Snower vorangetriebene Streben nach Forschungsexzellenz und aktueller Relevanz reizten. „Diese Kombination aus Weltwirtschaft und Exzellenz gibt es in Deutschland nicht noch einmal.“ Zu Trebeschs Portfolio sind in Kiel noch das politische Thema Populismus und geoökonomische Themen wie das Tracking der staatlichen Ukrainehilfen und die Rolle Chinas als Gläubiger hinzugekommen – alles Themen, zu denen es keine fertig aufbereiteten Daten gab, also kein testbares Material. Den Ukraine Support Tracker bezeichnet Trebesch als das einflussreichste Projekt, an dem er je gearbeitet habe.
Was ihn als Wissenschaftler ausmacht, bringt er auf folgenden Nenner: „erstens das empirische Anpacken von Themen, die bisher für Ökonomen kaum greifbar waren; zweitens das Lernen aus der Vergangenheit und das Erkennen von Mustern in langen Zeitreihen; drittens das Interesse für Schwellen- und Entwicklungsländer; viertens die Offenheit für Erkenntnisse aus anderen Disziplinen“. Der Europäische Forschungsrat sprach ihm 2023 ein Consolidator Grant für sein geoökonomisches Projekt „International Finance and the Great Powers, 1800–2020“ zu – 2 Millionen Euro über 5 Jahre. Und der mit 10.000 Euro dotierte Gossen-Preis stockt mindestens die private Reisekasse ordentlich auf.
© 2024 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Artikel in diesem Heft
- Frontmatter
- Editorial
- Preisträger im Fokus
- Aus Wissenschaft und Verein
- „Die zweite Amtszeit Trumps wird vermutlich sehr viel folgenschwerer als die erste“
- „Es ist nicht so einfach, gegen falsche Überzeugungen anzugehen“
- Planetarische Müllabfuhr – Gamechanger der Klimapolitik?
- Beiträge aus der Forschung zur Wirtschaftspolitik
- Der CO2-Preis in Deutschland: Verteilungswirkungen und Möglichkeiten der Rückverteilung
- CO₂-Bepreisung in Deutschland: Kenntnisstand der Bevölkerung im Jahr 2022
- Analyse der Einkommens- und Beschäftigungswirkungen einer Einführung des CDU-Konzepts der „Aktiv-Rente“
- Nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung durch inter- und intragenerative Umverteilung – ein Reformvorschlag als Generationenkompromiss
- Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- Bedingungsloses vs. haushaltstyp- und wohnortabhängiges Grundeinkommen: Simulation verschiedener Reformszenarien für Deutschland
- Die Ungleichheit der zu versteuernden Vermögen in der Schweiz während der Covid-19-Pandemie
Artikel in diesem Heft
- Frontmatter
- Editorial
- Preisträger im Fokus
- Aus Wissenschaft und Verein
- „Die zweite Amtszeit Trumps wird vermutlich sehr viel folgenschwerer als die erste“
- „Es ist nicht so einfach, gegen falsche Überzeugungen anzugehen“
- Planetarische Müllabfuhr – Gamechanger der Klimapolitik?
- Beiträge aus der Forschung zur Wirtschaftspolitik
- Der CO2-Preis in Deutschland: Verteilungswirkungen und Möglichkeiten der Rückverteilung
- CO₂-Bepreisung in Deutschland: Kenntnisstand der Bevölkerung im Jahr 2022
- Analyse der Einkommens- und Beschäftigungswirkungen einer Einführung des CDU-Konzepts der „Aktiv-Rente“
- Nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung durch inter- und intragenerative Umverteilung – ein Reformvorschlag als Generationenkompromiss
- Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- Bedingungsloses vs. haushaltstyp- und wohnortabhängiges Grundeinkommen: Simulation verschiedener Reformszenarien für Deutschland
- Die Ungleichheit der zu versteuernden Vermögen in der Schweiz während der Covid-19-Pandemie

