Reviewed Publication:
Michael Madeja / Joachim Müller-Jung (Hrsg.): Hirnforschung – was kann sie wirklich
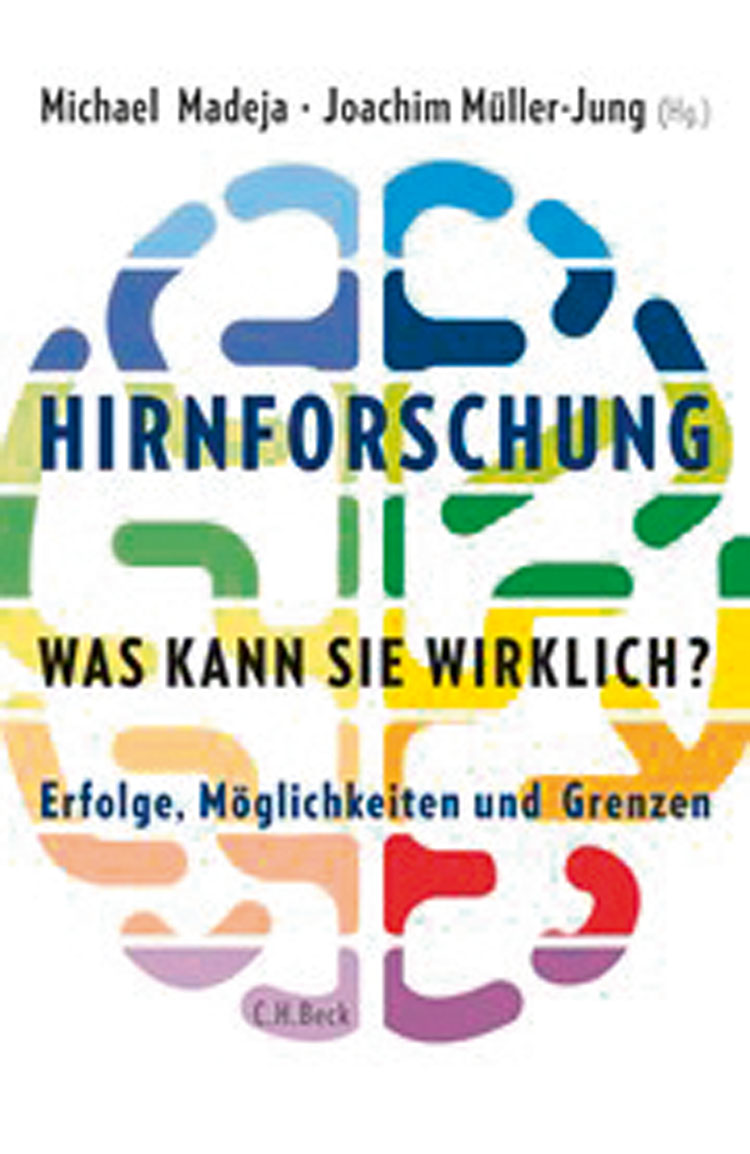
Einladung zum Dialog
Der Titel des Buchs verspricht wenig Neues – zu oft wurde die Frage nach Geltungsbereich, gesellschaftlichem Anspruch und Verheißungen der Hirnforschung in den letzten Jahren bereits beantwortet. Warum sollten Neurowissenschaftler also ein weiteres populäres Buch zur Hirnforschung lesen? Und warum sollte man es Schülern, Studenten, Fachlehrern oder gar der breiten Öffentlichkeit empfehlen? Eine Antwort findet sich in dem Kapitel zur Neurodidaktik, das der Mitherausgeber Michael Madeja mit einer Beschreibung des dialektischen Dreischritts einleitet, durch den diese junge Disziplin in den letzten drei Jahrzehnten gegangen ist. Am Anfang standen Euphorie und Heilserwartungen einer umfassenden, neurobiologisch begründeten Bildungsreform. Dies führte zu einer massiven Abwehr der befürchteten naturwissenschaftlichen Usurpation durch akademische Pädagogen und didaktische Praktiker. Es kam zu einer Phase der Ernüchterung und – leider! – zu einem weitgehenden Stillstand des Dialogs. Schließlich hat sich die aufgeregte Debatte normalisiert, sodass nun die „Trennung von Wunschdenken und tatsächlichen Optionen“ möglich ist. In diesem Spannungsfeld aus wissenschaftlichem Optimismus, realistischer Standortbestimmung und kritischer Reflektion der disziplinären Grenzen bewegt sich das gesamte Buch, das als eine Einladung zum Gespräch mit benachbarten Fächern und mit der ganzen Gesellschaft gelesen werden kann.
Michael Madeja, bis vor kurzem Geschäftsführer der Hertie-Stiftung und Joachim Müller-Jung, Leiter des Ressorts „Natur und Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben vor zwei Jahren eine weithin beachtete Vortragsserie zusammengestellt, in der führende Hirnforscher über Funktionen des Gehirns, Implikationen für unser Selbstverständnis, Störungen von Hirnfunktionen und Beiträge der Hirnforschung zu gesellschaftlichen Problemen berichten. Es ging ihnen um einen Überblick „frei von Träumen und unrealistischen Erwartungen, aber auch frei von Ressentiments und plakativen Negativbeispielen“. Die nun vorliegende Sammlung der aus den Vorträgen hervorgegangenen Artikel behandelt eine breite (wenn auch zwangsläufig unvollständige) inhaltliche Palette von den neuronalen Mechanismen des räumlichen Gedächtnisses bis zu neuen Disziplinen wie Neurodidaktik und Neuroökonomie. Allen Aufsätzen ist gemein, dass sie bei aller Begeisterung über den wachsenden Erklärungsbereich neurobiologischer Forschung zugleich die Grenzen des eigenen Gebietes in den Blick nehmen. Die Relativierung des eigenen Ansatzes als einem von mehreren möglichen Zugangswegen steht in wohltuendem Kontrast zu dem präpotenten Dominanzgebaren mancher Texte der Vergangenheit, die zu vorhersehbaren Enttäuschungen und berechtigten Abgrenzungen anderer Fachgebiete geführt haben. Gleichzeitig lassen die Autoren aber keinen Zweifel an ihrem Optimismus, dass ihr je eigenes Forschungsgebiet hoch relevante Beiträge weit über den innerfachlichen Diskurs hinaus leisten kann. Zwischen den rapide wachsenden Möglichkeiten der Neurobiologie und den vielen ungelösten Problemen von Grundlagenforschung und Klinik sieht der eine das Glas halbvoll, der andere findet es halbleer – alle lassen aber Raum für einen offenen Dialog mit den anderen Natur- und Humanwissenschaften.
Neurowissenschaftlern erschließen sich die allgemeinverständlich dargestellten biologischen Inhalte natürlich schnell, manchmal sogar beim „Querlesen“. Man sollte aber die Sorgfalt der Autoren wie der Herausgeber nicht unterschätzen, die fast durchweg zu flüssig geschriebenen, kohärenten Darstellungen mit klug gewählten Beispielen und ausgewogenen Formulierungen geführt haben. Interessant ist, gerade für den fachnahen Leser, das wiederholte Auftauchen von Leitmotiven, die offenbar feste Topoi in den verschiedensten neurowissenschaftlichen Subdisziplinen darstellen: Die Bedeutung neuronaler Plastizität als Grundlage erfahrungsabhängiger Anpassung, die Herleitung des adulten Zustands aus der Ontogenese, die „teleonomische“ Erklärung verhaltenssteuernder Funktionen aus Evolution und Ökologie. Auch auf der Meta-Ebene der Verortung des eigenen Ansatzes bestehen erstaunliche Parallelen – viele Autoren betonen, dass menschliches Denken und Handeln nicht identisch mit den Hirnfunktionen ist. Es sind eben Menschen, nicht Gehirne, die denken und handeln, die unterrichtet und bei Krankheiten behandelt werden. Man gewinnt den Eindruck, dass die kritische Diskussion der letzten Jahre am Selbstverständnis der Hirnforscher nicht spurlos vorbeigegangen ist. Dies gilt auch für die Anwendung der Hirnforschung in Neurotechnik und Therapie – die meisten Beiträge betonen neben den Chancen auch die Begrenzungen und Risiken neurobiologischer Eingriffe. Selbst auf die traditionellen Grabenkämpfe zwischen biologischer Psychiatrie und Psychoanalyse wartet man weitgehend vergeblich –mehrfach wird die von Freud vertretene Hoffnung auf eine naturwissenschaftliche Fundierung geistiger Funktionen zitiert, ohne in platten Reduktionismus zu verfallen. Dass Gerhard Roth bereits im Titel seines lesenswerten Textes „Wie das Gehirn die Seele formt“ die neurobiologischen Muskeln spielen lässt und auch später einen Primat der Hirnforschung einfordert, tut seinem integrativen Ansatz aus Psychotherapie, allgemeiner Physiologie und Neurobiologie keinen Abbruch.
Am Ende des Bandes stehen drei Außensichten – „Betrachtungen“ des Philosophen Gert Scobel, der Psychoanalytikerin Marianne Leuzinger-Bohleber und des Soziologen Armin Nassehi. Mit diesen Ergänzungen haben die Herausgeber den Kontext der vorherigen Aufsätze klug erweitert und Denkanstöße ermöglicht, die Ausgangspunkt fruchtbarer Dialoge werden könnten. Beeindruckend ist die affirmative Haltung der Psychoanalytikerin, die neurobiologische Validierungen therapeutischer Verfahren begrüßt, nützliche Erkenntnisse pragmatisch aufgreift (Bsp. Schlafforschung, Traumaforschung) und gleichzeitig Augenhöhe der Psychoanalyse als Zugang zum ganzen Menschen (eben nicht nur zum Hirn) einfordert. Armin Nassehi zieht eine überraschende Parallele zwischen Soziologie und Hirnforschung – beide lassen sich als Emanzipationswissenschaften verstehen, die natürliche oder soziale Randbedingungen des Menschen untersuchen, um auf Basis dieser (an)erkannten Beschränkungen Individualität und Freiheit zu konstituieren. Sie sind damit Aufklärung im eigentlichen Sinne. Der Philosoph Gert Scobel hingegen beginnt mit berechtigten Hinweisen auf die notwendige – und vernachlässigte – methodische Reflektion der Neurowissenschaften, steigert sich aber dann leider in immer schwerwiegendere und anklagendere Monita – beginnend mit der Feststellung einer fehlenden Universaltheorie vom Gehirn über das ungelöste Problem der Subjektivität bis hin zur Theorievergessenheit angeblich rein empirischer Forschungen im Wettbewerb um immer größere Geldmittel. So kommt er schließlich zu einem Zerrbild der Neurobiologie, bei dem Hinweise auf den nationalsozialistischen Missbrauch neuronaler Lokalisationstheorien und die Auslösung von Suiziden und Amokläufen durch die „typische“ Behandlung jugendlicher Depressiver mit Psychopharmaka nicht fehlen dürfen. Diese für einen Philosophen erstaunliche Komplexitätsreduktion führt zurück in plakative und entwertende Konfrontationen, die wir dringend überwinden sollten. Herrn Scobel sei darum ganz besonders die Lektüre der nachdenklichen, klugen und im besten Sinne selbstbewussten Aufsätze des vorliegenden Buches empfohlen.
Michael Madeja/Joachim Müller-Jung (Hrsg.): Hirnforschung – was kann sie wirklich? Erfolge, Möglichkeiten, Grenzen
Verlag C. H. Beck München 2016: 240 Seiten, 18 Fotografien
ISBN: 978-3-406-68880-5 (Hardcover) 19,95 €
ISBN: 978-3-406-68881-2 (eBook) 15,99 €
© 2018 by De Gruyter
Articles in the same Issue
- Frontmatter
- Übersichtsartikel
- Selektive Degeneration dopaminerger Neurone beim Parkinson-Syndrom: die zunehmende Rolle von veränderter Kalziumhomöostase und nukleolärer Funktion
- Selective degeneration of dopamine neurons in Parkinson’s disease: emerging roles of altered calcium homeostasis and nucleolar function
- Altruismus aus Sicht der Sozialen Neurowissenschaften
- Altruism from the Perspective of the Social Neurosciences
- Lebensbedingungen haben einen starken Einfluss auf die Plastizität des Gehirns
- Environmental conditions strongly affect brain plasticity
- Die neuronalen Signale, die Wahrnehmung verändern
- The neural events that change perception
- Der Einfluss von Fortbewegung auf die sensorische Informationsverarbeitung und die zugrunde liegenden neuronalen Schaltkreise
- The influence of locomotion on sensory processing and its underlying neuronal circuits
- Forschungsförderung
- Sonderforschungsbereich (SFB/TRR 167) NeuroMac „Entwicklung, Funktion und Potenzial von myeloischen Zellen im zentralen Nervensystem“
- Rezension
- Michael Madeja/Joachim Müller-Jung (Hrsg.): Hirnforschung – was kann sie wirklich
- Nachrichten
- Neue NWG-Website
Articles in the same Issue
- Frontmatter
- Übersichtsartikel
- Selektive Degeneration dopaminerger Neurone beim Parkinson-Syndrom: die zunehmende Rolle von veränderter Kalziumhomöostase und nukleolärer Funktion
- Selective degeneration of dopamine neurons in Parkinson’s disease: emerging roles of altered calcium homeostasis and nucleolar function
- Altruismus aus Sicht der Sozialen Neurowissenschaften
- Altruism from the Perspective of the Social Neurosciences
- Lebensbedingungen haben einen starken Einfluss auf die Plastizität des Gehirns
- Environmental conditions strongly affect brain plasticity
- Die neuronalen Signale, die Wahrnehmung verändern
- The neural events that change perception
- Der Einfluss von Fortbewegung auf die sensorische Informationsverarbeitung und die zugrunde liegenden neuronalen Schaltkreise
- The influence of locomotion on sensory processing and its underlying neuronal circuits
- Forschungsförderung
- Sonderforschungsbereich (SFB/TRR 167) NeuroMac „Entwicklung, Funktion und Potenzial von myeloischen Zellen im zentralen Nervensystem“
- Rezension
- Michael Madeja/Joachim Müller-Jung (Hrsg.): Hirnforschung – was kann sie wirklich
- Nachrichten
- Neue NWG-Website

