Zusammenfassung
Als Regionale Open-GLAM-Labore (Open GLAM Lab) können Initiativen, Projekte und Arbeitsweisen in Bibliotheken, Archiven und anderen Kulturinstitutionen wie bspw. Geschichtsvereine bezeichnet werden, um landeskundliche Wissens- und Datenbestände zugänglich zu machen, zu öffnen, zu publizieren, zu verknüpfen, diese zu editieren, wechselseitig mit dauerhaften Lerneffekten.
In solchen Umgebungen lernen Menschen und ihre Institutionen und dabei lernen wir: Menschen, die in Bibliotheken arbeiten, lernen, forschen und verwalten. Der Artikel skizziert den Vorschlag Regionales Open-GLAM-Labor als Kontaktzone in Gedächtnisinstitutionen und Bildungseinrichtungen sowie als nicht-technisches Modul für Landeskundeportale wie Saxorum mit dem Anliegen mit offenen Lern- und Vermittlungspraktiken Gelegenheiten für offene GLAM-Projekte von unten zu provozieren und selbst zu schaffen. Es geht dabei um Outreach und Impact – gesellschaftliche Wirkung öffentlicher Investitionen in digitale und nicht-digitale Infrastruktur. Kooperieren, um zu lernen und offen zu dokumentieren: Wie können wir gemeinsam Wirkungen verdoppeln?
Abstract
Regional Open GLAM Labs can be defined as initiatives, projects and working methods in libraries, archives, and other cultural institutions, such as historical societies, to make regional knowledge and data accessible, open it up, publish it, link it, and edit it, with reciprocal and lasting learning effects.
In such environments, people and their institutions learn, and we learn in the process: People who work, learn, research, and manage in libraries. The article outlines the idea Regional Open GLAM Lab as a contact zone in memory institutions and educational establishments and as a non-technical module for regional studies portals such as Saxorum with the aim of provoking and creating opportunities for open GLAM projects bottom up with open learning and mediation practices. This is about outreach and impact ‒ the social impact of public investment in digital and non-digital infrastructure. Co-operate to learn and document: How can we double impact of GLAM nearby?
1 Lernen im Labor nebenan
Ziel mit und in GLAM-Institutionen (Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen) kann es sein, öfter spartenübergreifend zu kooperieren, indem an moderne Entwicklungen ‒ technologische wie soziokulturelle ‒ Anschluss gesucht wird, damit die Relevanz auch für jene Gruppen neu hergestellt werden kann, deren Nutzungsverhalten sich verändert hat. Um Quellen und Themen der Landeskunde zu popularisieren, digitale Methoden und der Offenen Wissenschaft auszuprobieren, um Zugänge und Wissen digital zu vermitteln, Mitarbeit, Feedback und Austausch zu ermöglichen, um anschlussfähig zu bleiben oder wieder zu werden. Möglicherweise gilt es, Nutzer:innen anzulocken oder selbst gelegentlich in und mit anderen Sammlungen und Archiven zu arbeiten sowie öffentliche Ressourcen neu zu legitimieren. Der Vorschlag ist hier: Etabliert Open-GLAM-Labore für offene Kulturdaten der Region.
1.1 Offenheit?
Eine Herausforderung von Openness in Gedächtnisinstitutionen besteht darin, abstrakte Begriffe, Konzepte, Fachsprache und Handlungsprinzipien für Offenheit wie Offene Kulturdaten, Linked Open Data, Open GLAM, Crowdsourcing, Open Citizen Science, Wikiversum oder Metadatenaktivismus an Beispielen individuell möglichst verständlich leicht erfahrbar, nutzbar und anwendbar zu machen. Zu machen im Sinne von Making: eigenes Ausprobieren, Verändern, Kombinieren, Verknüpfen, Gestalten, eigenes Editieren und eigenes offenes Publizieren. Regionale Open GLAM Labs fungieren dann in Anlehnung an Library Labs bzw. Open GLAM labs[1] als Lerngelegenheiten für Profis wie für Laien regional bzw. vor Ort.[2] Nearby bzw. lokal im GLAM-Labor nebenan, um selbst Erfahrungen zu sammeln mit digitalen Werkzeugen, Versuchen und deren Wirkungen – individuell, institutionell und strukturell. Fachsprachliches Erschließen von Sammlungsgut in Bibliotheken oder Archiven oder Kunstsammlungen meint möglicherweise im Detail verschiedene Methoden und Tätigkeiten. Die Eigenheiten ähnlicher Arbeitsweisen innerhalb und außerhalb von Sammlungsinstitutionen werden in Kooperationen deutlich bzw. in laborhaften Projekten mit ungewohnten Vorgehensweisen.
Was hilft in regionalen Kulturdatenräumen? Sich treffen: online sowie durch persönliche Besuche, mit Methodenvermittlung und Edits an gemeinsamen Projekten, Reflexion und Publikationen darüber.
1.2 Details bearbeiten
„Edit it!“ soll hier und für offene regionale GLAM-Labore als Maxime gelten: Ideen, Werke, Objekte und Methoden öffnen, vorzeigen, pragmatisch verändern, verknüpfen und kontextualisieren – zugänglich machen für offene Nutzungen, Remix und Detailerschließung durch Dritte. Solche Praktiken verändern Bibliothek und andere Kultureinrichtungen nicht zuletzt durch Perspektivwechsel, die in Kooperationen als Teil offener Bildungspraktiken interpretiert werden können. Beispielsweise
Lernen durch Einblicke in benachbarte (Sammlungs-)Kontexte eigener Arbeitsthemen und in die Sammlungen und Metadaten anderer Institutionen,
in Bezug auf Wirkungen von Interaktion durch Benutzung, Remix, Verknüpfung und den medialen Austausch darüber,
kontinuierliche Metadatenanreicherung und Validierung durch Dritte gegenüber eher statischer Erschließungstiefe von Sammlungen,
mit Communityorientierung, bspw. Betreutes Klicken für Links und lebendige Beziehungen von Nutzenden und mit weiteren Daten aus offenen Quellen gegenüber Daten- und Wissensverwaltung insb. für eigene Sammlungsbestände,
kontinuierliches Berichten und Reflektieren integriert in die Erschließungs- und Forschungsprozesse gegenüber Wissens- und Wissenschaftskommunikation über Projekterfolge und Projektergebnisse zu Projektende, oder
die Nutzung sozialer und damit eher informeller Infrastrukturen für und mit Menschen, die selbst forschen und entwickeln gegenüber bzw. ergänzend zu den technischen Informationsinfrastrukturen in Bibliotheken.
Was kann das konkret bedeuten? Vielleicht helfen Illustrationen aus Projekten und Kooperationen mit dem Dresdner Geschichtsverein, mit Kolleg:innen in Archiven und Bibliotheken, mit Grafiker:innen und Wikimedians – für gemeinfreie Vereinspublikationen und Tafellieder.[3]
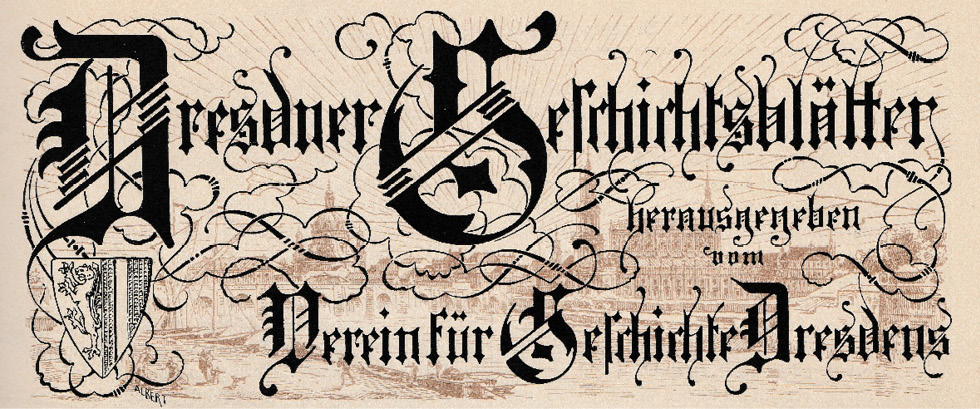
Titelkopf der Dresdner Geschichtsblätter ab 1892, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dresdner_Geschichtsbl%C3%A4tter_-_Titel.jpg

Scalable Vector Graphic (SVG) einer Illustration von drei Tafelliedern und Liedzetteln, Th. Ziegners Buchdruckerei, Kötzschenbroda, 1890, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwerg_1890.svg
1.3 Open-GLAM-Arbeitsweisen institutionalisieren
Mit offenen Kulturdaten als Vereinsprojekt des Dresdner Geschichtsvereins wächst seit 2022 eine lokale Gemeinschaft Engagierter, die historische Vereinspublikationen durch neue Volltexte, Illustrationen und offene Metadaten erschließen.[4]
Zunehmend werden Wikisource-Transkripte in der Landesbibliografie nachgewiesen, bibliothekarisch erschlossen und so als Output bürgerwissenschaftlichem Engagements auch über die Sächsische Bibliografie und den Katalog der SLUB Dresden recherchierbar.[5]
Am Staatsarchiv Leipzig entstand 2023 eine Landkarte der dortigen Archivbestände mittels offener Metadaten in Wikidata. Als Wikimedian in Residence dokumentierte der Autor mit einer Wikiversityseite[6] und Blogposts[7] diese Kooperation mit dem Sächsischen Staatsarchiv.[8]
Transkripte lokaler Wochenblätter des März 1848 entstanden zuvor mit dem Stadtarchiv Kamenz auf Basis unveröffentlichter Transkripte und Ergänzungen in Wikisource.[9]
Diese Beispiele verdeutlichten Potentiale offener Kooperationen zwischen einer Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek, Vereinen, Stadt- und Staatsarchiven auf unterschiedliche Weise mit Vermittlungsmethoden, die grundlegende Kulturgutdigitalisierungen veredeln: Können wir solche Arbeitsweisen mit Open-GLAM-Laboren regional stärken, indem wir sie institutionalisieren?
1.4 Kontaktzonen mit offenen Daten und Metadaten
Demokratischer und partizipativer wird die Beschreibung der Welt in Bibliotheken mit offenen Metadaten und die Beteiligung bisher Unbeteiligter von außen: Sammlungen profitieren, wenn Laien und Profis anderer Wissensgebiete beispielsweise orts- oder landeskundliche Informationen ergänzen, korrigieren und verknüpfen. Professionelle Präsentationen, Editionen und die Erforschung digitaler Objekte sind längst mit offenen Werkzeugen möglich, die außerhalb kontrollierter eigener Informationsinfrastrukturen betrieben und entwickelt werden, z. B. mit Mitteln der Wikimedia-Bewegung. Etwaige Weiterbildungsbedarfe sind vielfältig, die dafür in GLAM-Institutionen nötig und dann beobachtbar werden: für Werkzeuge, Methoden, Freiräume, Kommunikation und community-orientierte Arbeitsweisen. Folglich sind Lern- und Vermittlungsmethoden divers, die institutionell und individuell für offene GLAM-Kooperationen hilfreich und wirkungsvoll sind.
Bibliotheken können regional als Labor fungieren und Kontaktzonen bieten für die Kooperation von Akteuren in Gedächtnisinstitutionen und Bildungseinrichtungen sowie Bürger:innen, die forschen und entwickeln, deren Initiativen und bürgerwissenschaftlichen Vereinen oder mit öffentlichen Verwaltungen, Rathäusern und Ministerien. Ein regionales Open-GLAM-Labor wäre in diesem Sinne ein physischer und/oder digitaler Ort bzw. Raum mit Kontaktgelegenheiten oder ein Rahmen mit Ansprechpartner:innen, in dem offene Kulturdaten institutionenübergreifend bearbeitet, neu publiziert und verknüpft werden können, also Ideen und das Wissen für deren Realisierung: Bibliothekslabore als Makerspaces für offene Kulturdaten aus digitalisierten und nicht digitalen Sammlungen samt offenen Metadaten, Experimentier- und Lerngelegenheiten.
Nutzer:innen von Sammlungsinstitutionen wünschen, benötigen oder haben selbst Methodenwissen. Dem angestellten Personal in Bibliotheken, Archiven, Museen und Kunstsammlungen geht es nicht anders bzw. ähnlich. Oder sie bieten gegenseitig Neugier, Expertise, Engagement und Zeit – in und für Sammlungen und für deren Objekte. Dann könnten sie zusammenarbeiten, sprichwörtlich auf Augenhöhe bzw. in unterschiedlichen Projektanforderungen und Projektzusammenhängen in variablen Rollen. Wer dabei die Profis und wer die Laien sind, ist in offenen Kulturdaten- und Open-Citizen-Science-Projekten nicht unbedingt eindeutig; Expertise ist nicht homogen verteilt. Gelernt wird dann durch geteiltes Wissen und geteilte Erfahrung gemeinsamer Projektpraxis.
1.5 Open Educational Practices mit GLAM
Offene Bildungspraktiken,[10] die lokal oder regional orientiert Zugänge zu Informationen schaffen, offene Arbeitsweisen popularisieren, Zusammenhänge vermitteln sowie Austausch zwischen Sammlungsprofis und Laien schaffen, sind dann beispielsweise
neue Open Access-Publikationen bislang unveröffentlichter Medien, Daten und Versionen,
geteilte Ideen für deren Verwendung und Verknüpfung, z. B. durch Prototypen und Dokumentationen,
sowie deren pragmatische Umsetzungen hands on in offenen Dateninfrastrukturen,
Weiterbildungen mit Anwendungswissen und Beratung für digitale Werkzeuge und Methoden (Transkription, offene Metadaten, OER) für offene Erschließungs-, Forschungs- und Publikationsmethoden,
Wissens- und Wissenschaftskommunikation mit offenen Daten und Metadaten,
forschungsorientierte Crowdsourcing-Initiativen,
bürgerwissenschaftliche Forschung und Entwicklung mit Open-Citizen-Science-Projekten, selbständig und/oder angeleitet,
offen publizierte Projektberichte, Methodendokumentation und Reflexion,
Methodenentwicklung für Kooperationen mit offenen Kulturdaten.
Sind solche Kooperationen jeweils neues Terrain für beteiligte Akteure? Vermutlich längst nicht für alle. Zusätzliche und regelmäßige Gelegenheiten sowie Freiräume für Zusammenarbeit dürften die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass neue Projekte entstehen, die Regionalia verknüpfen: Themen, Medien, Sammlungen, Daten, deren Abfragen und Gemeinschaften.
1.6 Führung und Organisationsentwicklung
Auch Menschen in Leitungs- und Entscheidungspositionen an offenen GLAM-Kooperationen beteiligter Institutionen in Wissenschaft, Verwaltung und der Bürgergesellschaft haben Wissenslücken, und sie sind offen für offene Arbeitsweisen und Kooperation. Oder sie suchen Ressourcen: zusätzliche Zeit, Anwenderwissen, Weiterbildung, Kontakte und Budgets, durch Synergien und veränderte Prioritäten.
Offene GLAM-Kooperationen profitieren von persönlichen Kontakten mit Kolleg:innen, von Anfragen Forschender, durch kollegiale Beratung, Weiterbildung oder von motivierenden Funden und gemeinsamer Infrastruktur – in offenen Labor-Umgebungen mit arbeitsteiligen Projektansätzen durch Crowdsourcing, Impulse durch Forschungsfragen und geteilte Ressourcen.
Wie sollten sich Bibliotheken weiterentwickeln, um an Schnittstellen, in Kontaktzonen für GLAM-Institutionen, Forschungseinrichtungen und mit forschenden Bürger:innen kommunikations-, projekt- und ggf. förderfähig zu sein?
2 Call for Edits!
Call for Edits in GLAM-Laboren sind dann Aufrufe für Bearbeitungen offener Kulturdaten, für neue Versionen, Kombinationen und den Remix von Sammlungsobjekten sowie der Metadaten. Aber auch Begriffe, Konzepte, Institutionen, Verhaltensmuster und dominante Paradigmen der jeweiligen Branchen können verändert – editiert, ergänzt, bearbeitet – werden im übertragenen Sinne sowie deren Metadaten, um sie wirkungsvoll zu verknüpfen, im Bibliothekswesen (wissenschaftliche und Öffentliche Bibliotheken), im Archivwesen (Staats-, Stadt- und andere Archiveinrichtungen) oder in Sammlungen, in Geschichts- und Heimatvereinen. Edits an regionalen Wissensbeständen und deren offenen Daten betreffen dann über einzelne Werke und Medien hinaus auch die regionalen Informationsinfrastrukturen, Kooperationen, Experimente und Pilotprojekte, Wissenskommunikation, Erschließungs- und Versionsgeschichten, Begleit- und Wirkungsforschung und Agenda Setting.
2.1 Labore für regionale Links, Themen und Ideen
Geschichte, Forschungsthemen und Geschichten können von Bürger:innen und Kulturinstitutionen regional und lokal gemeinsam offen präsentiert, gebündelt, genutzt oder erforscht werden. Ansätze und Methoden sind dafür beispielsweise:
Werke der Kunst- und Regionalgeschichte sehr detailliert erschließen,
alle historischen Publikationen aller Geschichtsvereine transkribieren,[11]
Firmenarchive bearbeiten, erschließen und veröffentlichen,
Illustrationen historischer Klischees mittels Vektorgrafiken neu veröffentlichen,
alte Tafellieder suchen, finden, scannen, transkribieren oder singen.
Solche Aktivitäten finden längst statt, in Kontakt mit GLAM-Institutionen zuweilen, oft autark, selbständig initiiert und durchgeführt. Der Wikipedia-Stammtisch Dresden traf sich seit 2008 schon über 200 Mal. Bibliotheken und ihre Mitarbeiter:innen können bei solchen Gelegenheiten sich, ihre Themen und Sammlungen präsentieren und kooperieren. Erfahrungsgemäß sind die Anliegen oft wechsel- und vielseitig: Digitalisierungswünsche, Korrekturvorschläge für Katalog- und Normdaten, Führungen in Kultureinrichtungen, Erwerbungswünsche und Austausch sowie Unterstützung in Erschließungsprojekten der Wissenschaft oder in Wikimediaportalen – oder einfach: ein neuer Wikipedia-Artikel. Falls diese Zusammenarbeit mit Akteuren regionaler Wissensproduktion noch nicht etabliert ist, können Bibliotheken Gelegenheiten schaffen fürs Kennenlernen, Austausch und Projektanbahnung, fortlaufend durch eigene Aktivitäten, Einladungen und Veranstaltungen. Als Community-Building ließe sich solche Netzwerkarbeit gemeinsam mit Archiven, ggf. einer Landesfachstelle für Bibliotheken und mit Kolleginnen anderer GLAM-Institutionen in einem offenen regionalen GLAM-Labor bündeln; auch um Lern-, Entwicklungs-, und Editbedarfe zu identifizieren.
2.2 Lernen für und mit historischen Quellen und offenen Daten
Was passiert mit einem regionalen Open-GLAM-Labor und wie? Datenpflege, neue Open Educational Resources, Verknüpfungen und darauf aufbauende Produkte und Datendienste sind ohne Lerneffekte und Training nicht einfach zu haben. Einige Vorschläge für Aktivitäten in offenen GLAM-Laboren ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Nearby[12] ist eine Wikidata-Abfrage nächstgelegener Datenobjekte mit Geokoordinaten und für den Einstieg in die Arbeit und Datenpflege für das multilinguale Weltwissen der nahen Umgebung gut geeignet. 1Lib1Nearby für Wikidata ist eine Variante der Wikipedia-Kampagne 1lib1ref für zusätzliche Aussagen und Referenzen.
Regelmäßige informelle Onlinetreffen helfen Online-Communities als Erschließungsgemeinschaft zusammenzuhalten und ziemlich unwahrscheinliche Projekte erfolgreich zu bearbeiten.[13] Gemeint sind Projekte, die aufgrund großen Umfanges, langer oder unbestimmter Bearbeitungsdauer oder der angestrebten Erschließungstiefe eigentlich als unrealistisch erscheinen.[14]
Wikimedian bzw. Wikipedian in Residencies (WiR) sind Rollenmodelle, die auch als geteilte Ressource durch relativ kleine GLAM-Einrichtungen oder ggf. Konsortien erst ausprobiert und dann im Regelbetrieb etabliert werden könnten.[15]
Stadt- und Regionwikis bieten Bürger:innen, die forschen, Bibliotheken, Archiven und Bildungseinrichtungen digitale Orte für Links, Wissens- und Materialsammlungen zu lokalen Themen und für relevante Sammlungen.[16]
Offene Bürgerwissenschaft (Open Citizen Science) und Themen der Stadtentwicklung bieten Betätigungsfelder, für die offene Daten aus GLAM-Institutionen und öffentlichen Verwaltungen relevant sein können.[17]
Das Wikimediaportal Wikiversität eignet sich auch lokal und in regionalen Kontexten für offene Bildungsressourcen und deren Präsentation und kollaborative Erstellung mit Materialien der Wikimedia-Bewegung sowie anderen offenen Quellen des Webs.[18]
Wikisource-Bestände transkribierter Texte, ihrer Illustrationen sowie thematische Linklisten sind nützlich für Recherchen und den Nachweis digitalisierter Quellen, für digitale Editionen Forschender, von Bürger:innen oder Bibliotheken.[19]
Nicht zuletzt die umfangreichen öffentlichen Mittel für die Digitalisierung von Kulturgütern in Landesdigitalisierungsprogrammen und die wachsenden digitalen Sammlungen rufen nach zusätzlichen Investitionen auch in das Anwender:innenwissen, um die Wirkungen dieser Programme und Steuermittel zu steigern; Methodenwissen für Bürger:innen, Initiativen und Organisationen, die damit Wissen erschließen, editieren und neu publizieren.[20]
2.3 Informelle Infrastruktur
Regionale Kooperationen in Projekten zwischen Bibliotheken, Archiven, Vereinen, Verwaltungen und Bürger:innen profitieren von klassischen öffentlichen Informations- und Forschungsinfrastrukturen: Bibliotheks- und Archivsysteme, Forschungsinformationsdienste und von unabhängigen Angeboten bürgerschaftlicher Vereine,[21] Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata. Informellere Infrastrukturen ergänzen offizielle Netzwerke und Strukturen: Wikis, Weblogs, Stammtische, gegenseitige Besuche.[22]
Mit offenen informellen Infrastrukturen können Institutionen übergreifende Projektgemeinschaften wachsen. WikiKult ‒ Offene Kulturdaten ist seit 2024 dafür ein Beispiel. WikiKult ist ein unabhängiges Netzwerk von Expertinnen und Interessierten aus dem Kulturerbe-Sektor (Bibliotheken, Archive, Museen und Forschung) im deutschsprachigen Raum.[23] DatenlaubeJam ist ein wöchentliches Onlinetreffen mit Aktiven des Dresdner Geschichtsvereins für dessen historische Publikationen und offene Kulturdaten.[24] Digitale Sommerkurse eignen sich für kollegialen Austausch über Arbeits- und Alltagsthemen, Berichte über Tagungen, Forschungsreisen und -fragen.[25]
2.4 Wissenskommunikation mit Erschließungs- und Versionsgeschichten
Erschließungsgeschichten fördern Sichtbarkeit und Verständlichkeit abstrakter oder vermeintlich trockener Arbeit in Sammlungsinstitutionen. Wie entstehen und funktionieren offene Kulturdaten der Landeskunde und Ortsgeschichte? Wünschenswert ist selbstbewusste, anschauliche, offene Wissenskommunikation mit offenen Daten aus Projekten, in denen Kulturdaten entstehen und veredelt werden, über Zusammenhänge von Sammlungen, ihren Objekten und etwaige Fragen sowie Erklärungen des Nutzens und der Zusammenhänge mit und über offene Metadaten.
Versionsgeschichten in Wikis speichern und repräsentieren die Entwicklung jedes Artikels, jeder Diskussionsseite oder der Datenobjekte in Wikidata. Sie können für digitale Kommunikation über Arbeitsweisen und Forschungsthemen der Landeskunde in GLAM-Institutionen genutzt werden.[26] Weblogs sind als Infrastruktur dafür gut geeignet und werden längst von Bibliotheken und Archiven linked open für die Wissens- und Wissenschaftskommunikation und als offene Bildungsressourcen publiziert, beispielsweise
Sax-Archiv-Blog des Sächsischen Staatsarchivs,[27]
Saxorum der SLUB Dresden,[28]
ehemalige Bibliothek des DVW e.V., Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement,[29]
How to edit nearby mit Notizen für regionale Open-GLAM-Labore und offene Daten.[30]
Erschlossen werden Blogposts teils in Bibliothekskatalogen und mit offenen Metadaten in Wikidata.[31] Diese Methode eignet sich bspw. für erste Schritte und Edits in Wikidata und ermöglicht Verknüpfungen bibliografischer Daten und Editionen bürgerwissenschaftlicher Herkunft mit GLAM-Institutionen.
2.5 Geteilte Ressourcen
Stadtarchiven, Staatsarchiven, Öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken fehlen oft Zeit, Personal oder andere Ressourcen, um über gesetzliche Aufgaben, angestrebte Erschließungsqualität und Öffnungszeiten hinaus regelmäßig Zusatzleistungen für wünschenswerte Open-GLAM-, Crowdsourcing- oder Citizen-Science-Initiativen zu ermöglichen. Kulturgutdigitalisierung, digitale Tiefenerschließung und Präsentation, inzwischen KI sowie Haushaltssperren erfordern ohnehin zusätzliches Engagement, Kraft und Ideen. Auch neue Kooperationen erfordern Ressourcen.
Vor diesen Hintergründen könnte ein regionales Open-GLAM-Labor als geteilte Ressource helfen: eine Person, ein Team mit Stellenanteilen bzw. eine Organisationseinheit, die themen-, ideen- und community-orientiert Kulturinstitutionen besucht, begleitet und berät, um gemeinsam Pilotprojekte zu initiieren, zu realisieren, zu publizieren und mit anderen Akteuren zu verknüpfen.
Der Vorschlag neue Fähigkeiten für solche neuen Anforderungen in der Berufsausbildung zu verankern, liegt nah, führt in Bezug auf Lern- und Kooperationsbedarfe nicht unbedingt kurzfristig zum Ziel Anschlussfähigkeit. Digital skills für offene Kultur-, Daten- und Bildungsprojekte suchen und lehren beispielsweise Hochschulen, Universitäten und Schulen wie auch GLAM-Institutionen.[32] Pragmatische Weiterbildungen für Edits und Kooperationen mit offenen Kulturdaten sollten dann nicht auf den beruflichen Nachwuchs konzentriert bleiben. Ein Rollenmodell für temporäre oder unbefristete Vermittlungsaufgaben kann dann ein oder eine Wikimedian in Residence als ein Element eines regionalen GLAM-Labors sein.[33] Das folgende Zitat von Mellissa Highton von der University of Edinburgh illustriert die Notwenigkeit solcher Kooperationsmodelle. Sie sind übertragbar auf Bibliotheken, Archive, andere Sammlungen und ihre Kooperationen mit Freiem Wissen und mit offenen Daten:
This week I spoke at a Wikimedia Edu conference. I spoke about the value of wikimedians in residence (WiR) for higher education (HE). Some people have told me they can’t afford to host a wikimedian. I would argue you can’t afford not to.
There are 3 main reasons why you can’t afford not to. They are:
Universities must invest in digital skills.
Gender inequality in science and technology is a real thing.
Wikimedians will save us from Wikimedians.[34]
Werkzeuge und Gemeinschaften der Wikimedia-Bewegung können für Crowdsourcing und Open Citizen Science in GLAM eine wesentliche Rolle spielen, beispielsweise für kollaborative Erschließungsprojekte. Individuelles Lernen, soziale Dynamiken in den relevanten Wikimedia-Portalgemeinschaften sowie in beteiligten Institutionen (GLAM, Vereine oder Bildungsträger) wirken dabei wechselseitig aufeinander. Der Austausch in solchen Kooperationen beinhaltet Lernen, also Bildungspraktiken und möglichweise auch Widerstände – explizite oder implizite. Gibt es schon eine Sommerschule für interdisziplinäre Erschließungspraxis in Kunstsammlungen, Bibliotheken, Archiven, Museen und Bürgerwissenschaften? Ein regionales GLAM-Labor könnte solche Arbeitsweisen vermitteln und unterstützen.
2.6 Begleit- und Wirkungsforschung
Was sie bewirken können, für wen, in welchem Umfang und insbesondere in landeskundlichen Zusammenhängen, wie diese Wirkungen systematisch gemessen und gesteigert werden können, auch das sind Fragen für offene Forschungs- und Entwicklungs- und damit Bildungsprojekte. Regional, so der Vorschlag hier, im Austausch mit Menschen in Archiven, Museen, Vereinen, Kunstsammlungen und Bibliotheken.
Outreach umfasst verschiedene Maßnahmen, die Organisationen ergreifen, um aktiv Menschen und gesellschaftliche Akteure zu erreichen, die aus verschiedenen Gründen nicht daran teilhaben, sowie um erwünschte Wirkungen zu erzielen. Ein regional gedachtes Open-GLAM-Labor kann dafür Gelegenheiten schaffen und offene Arbeitsweisen ermöglichen in Kontaktzonen von GLAM mit Fachwissenschaft und Bottom-up-Initiativen der Zivilgesellschaft.
Dann bewirken Citizen-Science- und Open-GLAM-Kooperationen individuelle und institutionelle Lerneffekte, ggf. auch Reflexionsphasen und mit Einfluss auf Organisationsentwicklung, auf Ziele und Strategien, um diese Ziele zu erreichen. Dabei basieren Citizen-Science-, Open-Data- und Open-GLAM-Initiativen in unterschiedlichem Ausmaß und individuell auf Engagement, ebensolcher Expertise und auf eigenen Fragen, ungleichen Ressourcenausstattungen, Freiheitsgraden und Zwängen. Diese Grundlagen und Bedingungen für Kooperation prägen die Lernbeziehungen und die Praxis im Projektalltag.
3 Edits mit Versionsgeschichten: Open Educational Practices mit Bibliotheken
Dieser Text ist Teil einer Lernkurve, um zu formulieren – ausgehend von eigenen Arbeitsweisen – was ein regionales Open-GLAM-Labor sein könnte. Edits mit Versionsgeschichten als offene Lern- und Lehrpraxis zu interpretieren[35] und Bedarfe an digitalen Kompetenzen und Ressourcen in GLAM-Institutionen waren dafür Ausgangspunkt und das Credo „Someone has to organize it.“[36] Open Citizen Science, Edits und Versionsgeschichten mit Themen der Landeskunde liegen oft Neugier, Recherchen, Entwicklungsarbeit, Ausdauer und Kooperationen in Nutzer:innengemeinschaften zugrunde. Digitale Methodenvermittlung, Wissens(chafts)kommunikation, Freiräume für institutionenübergreifend gemeinsame Ziele und Projekte können Bibliotheken helfen, die Wirkungen ihrer Sammlungen und Metadaten zu steigern.
Der Text entstand im Frühjahr 2025 auch unter dem Eindruck autoritärer und faschistischer Umbrüche. Sie bedrohen offen-moderne[37] nicht weniger als konstitutionell-etablierte[38] Informationsinfrastrukturen global, regional und lokal.
Zugleich wuchsen hierzulande Gemeinschaftsprojekte in Leipzig,[39] Görlitz und online mit Paris[40] im Sinne der hier skizzierten Ideen. Darum gilt auch für digitale Methoden in Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen mit Bürger:innen, die sich selbst linked open Wissen erschließen, erforschen und entwickeln die Bitte: Lernt gemeinsam mit Edits – bildet Banden!
Über den Autor / die Autorin

Jens Bemme
Literaturverzeichnis
Beetham, H.; Falconer, I.; McGill, L.; Littlejohn, A. (2012): Open practices: briefing paper. JISC. Verfügbar unter https://oersynth.pbworks.com/w/page/51668352/OpenPracticesBriefing/.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2025a): Edited it. Open Educational Practices – Perspektiven für Bibliotheken mit GLAM (AT). Verfügbar unter https://nearby.hypotheses.org/1840.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2025b): Ziemlich unwahrscheinliche Projekte. Verfügbar unter https://nearby.hypotheses.org/3086.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2024a): Open a GLAM Lab? Als Wikimedian in Residence zwischen SLUB, Staatsarchiv Leipzig und Geschichtsverein Dresden. Verfügbar unter https://de.wikiversity.org/wiki/BiblioCON_2024/open_glam_lab/.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2024b): Wann korrigieren wir alle gemeinfreien Publikationen aller historischen Geschichtsvereine? #vBIB24. Verfügbar unter https://de.wikiversity.org/wiki/VBIB/vBIB24/Geschichtsvereine.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2023a): Projekt:Staatsarchiv Leipzig 2023. Verfügbar unter https://de.wikiversity.org/wiki/Projekt:Staatsarchiv_Leipzig_2023.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2023b): Links sammeln, Daten denken und umgekehrt: Themen, Archive, Geschichte, Medien und Geodaten. Verfügbar unter https://saxorum.hypotheses.org/10335, DOI: 10.58079/twer.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2021): Eigene Metadaten für eigene Blogposts – Wissenschaftskommunikation und Bibliografien mit offenen Daten und Wikidata. Verfügbar unter https://redaktionsblog.hypotheses.org/5219.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens (2022): Zeit für informelle Infrastruktur? Rückblick auf den 59. BibChatDe – für Geschichtsvereine und Bibliotheken. Verfügbar unter https://saxorum.hypotheses.org/7728, DOI: 10.58079/twd0.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens; Erlinger, Christian (2023): „Someone has to organize it“ – Widerstand linked open: 2040: Ideen und Spekulationen für offene Datenkulturen durch Wikimedians in Bibliotheken. In: BIBLIOTHEK ‒ Forschung und Praxis, 47 (1), 134‒38. DOI:10.1515/bfp-2022-0080.10.1515/bfp-2022-0080Suche in Google Scholar
Bemme, Jens; Erlinger, Christian (2023): Semestermodul Open Government und Open Data, Hochschule der Medien Stuttgart. Verfügbar unter https://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Open_Government_und_Open_Data_(HdM_2022).Suche in Google Scholar
Bemme, Jens; Flade, Juliane; Förster, Caroline (2022): DatenlaubeJam – Hackathon ist immer (dienstags). In: Gemeinschaften in Neuen Medien. Digitalität und Diversität. Mit digitaler Transformation Barrieren überwinden!? 25. Workshop GeNeMe22 Gemeinschaften in Neuen Medien, Dresden, 06.–07.10.2022. DOI:10.25368/2023.71.10.25368/2023.71Suche in Google Scholar
Bemme, Jens; Flade, Juliane (2024): Debriefing (Q2669680): Lernen, gemeinsam und mit offenen Daten im Sommer 24/8. Verfügbar unter https://osl.hypotheses.org/12668.Suche in Google Scholar
Bemme, Jens; Binder, Thomas; Erlinger, Christian (2024): Camenzer Wochenschrift – Pressefreiheit mit offenen Daten. DOI:10.58079/w4wl.Suche in Google Scholar
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2024): Citizen Science – Bürgerforschung in der Stadtentwicklung. Verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2024/bbsr-online-108-2024.html.Suche in Google Scholar
Erlinger, Christian; Bemme, Jens (2023): Kamptaler Sakrallandschaften im Wikiversum. In: LIBREAS. Library Ideas, 44, DOI:10.18452/28263.Suche in Google Scholar
Fischer, Daniel (2023): Citizen Science goes Sächsische Bibliografie: Wikisource-Transkripte bereichern SLUB-Katalog. Saxorum. DOI: 10.58079/twdx.Suche in Google Scholar
Fischer, Daniel (2025): Tafellieder sind kulturelles Erbe – Sammlung in der SLUB Dresden, Verfügbar unter https://saxorum.hypotheses.org/14088Suche in Google Scholar
Förster, Caroline (2023): Wie fetzig sind Geschichtsvereine? Die Projekte „#FetzigesGeschichtszeugs“ und „Die Datenlaube“ des Dresdner Geschichtsvereins, 149‒56. DOI:10.60684/msg.v55i1.40Suche in Google Scholar
DatenlaubeJam (2025): Notizen 2021 bis 2025. Verfügbar unter https://de.wikiversity.org/wiki/DieDatenlaube/Notizen.Suche in Google Scholar
Deutsches Historisches Institut Paris (2025): Pilotprojekt zur digitalen Erschließung von Altbeständen des DHIP. Verfügbar unter https://de.wikiversity.org/wiki/Projekt:Deutsches_Historisches_Institut_Paris_2025.Suche in Google Scholar
Highton, Melissa (2017): host a wikimedian: you can’t afford not to. Verfügbar unter https://thinking.is.ed.ac.uk/melissa/2017/02/20/roi.Suche in Google Scholar
HMT Leipzig (2025): Historische Studierendenunterlagen der HMT Leipzig. Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig: Bibliothek und Archiv. Verfügbar unter https://de.wikisource.org/wiki/Historische_Studierendenunterlagen_der_HMT_Leipzig.Suche in Google Scholar
International GLAM Labs Community (2019): Open a GLAM lab. Verfügbar unter https://glamlabs.io/books/open-a-glam-lab.Suche in Google Scholar
Kluttig, Thekla (2025): Tafellieder – eine noch zu entdeckende Textgattung. Verfügbar unter https://saxarchiv.hypotheses.org/44717.Suche in Google Scholar
Munke, Martin (2021): Dresdner Totengedenkbuch 1914–1918. Gemeinsames Crowdsourcingprojekt bürgerschaftlicher Vereine und wissenschaftlicher Bibliothek. Verfügbar unter https://saxorum.hypotheses.org/5967.Suche in Google Scholar
Munke, Martin; Bemme, Jens (2019): Bürgerwissenschaften in wissenschaftlichen Bibliotheken: Strategie- und kooperative Projektarbeit, Investitionen in offene Kulturdaten und in Anwenderwissen. In: O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal, 6 (4). DOI:10.5282/o-bib/2019H4S178-203.Suche in Google Scholar
Roth, Emma (2025): Trump DOJ goon threatens Wikipedia, in The Verge. Verfügbar unter https://www.theverge.com/news/656720/ed-martin-dc-attorney-wikipedia-nonprofit-threat.Suche in Google Scholar
Wikimedia (2025): Wikimedian in Residence. Verfügbar unter https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedian_in_residence.Suche in Google Scholar
WikiKult (2025): WikiKult ‒ Offene Kulturdaten. Verfügbar unter https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiKult_-_Offene_Kulturdaten.Suche in Google Scholar
Min Kim, Seung; Miller, Zeke; Mascaro, Lisa (2025): Trump fires Librarian of Congress Carla hayden. Associate Press, 9 May 2025. Verfügbar unter https://apnews.com/article/donald-trump-library-of-congress-carla-hayden-20a1862ce6d2e0d51a84a37b264ce2ef.Suche in Google Scholar
© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

